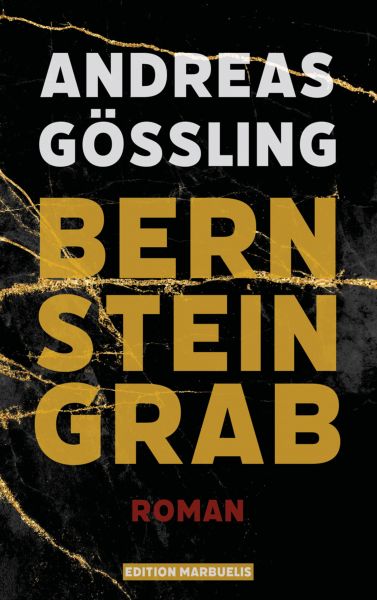Bernsteingrab
Nach dem Mauerfall will der Fotograf Timo Prohn, Nachfahr eines märkischen Adelsclans, das verfallene Familienschloss an der Oder wieder in Besitz nehmen. Doch bald schon kommt es zu verstörenden Zwischenfällen. Auf der Suche nach einer Erklärung stößt Timo auf ein finsteres Geheimnis ...
Ein literarischer Thriller, in dem es um deutsche Geschichte und Identität im ganz großen Bogen geht – von der Erbsünde der Preußen über die ,schwarze Romantik‘ und das ,Dritte Reich‘ bis zur Wiedervereinigung.
»Für mich zählt Bernsteingrab zu meinen gelungensten Romanen. Ähnlich meinem Erstling Der Irrläufer vereint er Thriller-Elemente mit literarischer Komplexität. Zusätzlich habe ich mich hier erstmals an einem geschichtlichen Stoff versucht, ohne zu ahnen, dass ich wenige Jahre später als historischer Romanschriftsteller bekannt werden würde: Mein erster Roman, der bei einem größeren Verlag erschien, war 2001 Die Maya-Priesterin.« Andreas Gößling
»Leseempfehlung für Liebhaber von spannenden und komplexeren Thrillern mit historischem Hintergrund« (recensio online)
»Sinnlich, mysteriös, grausam und bis zur letzten Zeile fesselnd.« (Gisbert Haefs über Die Maya-Priesterin)
»Ein teuflisch guter Roman.« (histo-couch.de über Faust, der Magier)
»Ein sagenhaft spannender Thriller.« (»Berliner Morgenpost« über Wolfswut)
»Ein genialer Fantasy-Detektiv-Roman.« (»Nautilus« über Der Ruf der Schlange)
Andreas Gößling
Bernsteingrab
Roman
Edition Marbuelis - Band 2
(c) Edition Marbuelis im Verlag MayaMedia GmbH, Berlin
Erster Teil: Die Orangerie
»Wie zauberisch diese Glaswand spiegelt:
Wer hindurch späht, sieht nach draußen
und mehr noch in sich selbst hinein.«
Ludwig Tieck
1
In der Nacht zum 18. Juni 1992 ging in der Gegend von Frankfurt ein ungewöhnlich starker Regen nieder; der Oststurm entwurzelte Dutzende Baumriesen; in einem Waldstück nahe Stiegliz spülten die Fluten eine Grabmulde frei und trommelten auf das Bündel in der Grube, das mit lindgrünem Plastik umwickelt und mit Lederriemen verzurrt war.
Gegen drei Uhr früh ließ der Regen nach, nicht so der Oststurm. Zu dieser Stunde war der Himmel über der Oder ein Wirrwarr fliehender Wolken, durch deren Bäuche die Mondsichel schnitt. Der Sturm zerknickte Baumgerippe, wühlte in den Fluten des Grenzstroms und heulte um die Wette mit Grauwolf und Mähnenwolf, die in den nahezu unwegsamen Wäldern seit Jahrhunderten ansässig sind.
Stiegliz ist ein schläfriger Bauernflecken, dessen zwölf oder vierzehn windschiefe Häuschen, zwischen Wiesen und Trauerweiden um den Dorfweiher aufgereiht, sich auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Lebus in eine Ufermulde schmiegen. Als die Morgensonne über der Oder, die allerlei Treibgut mit sich schwemmte, und über dem verwüsteten Waldstück aufging, war die Grabmulde zu einem Tümpel verwandelt, auf dem Zweige, vorjähriges Laub und lindgrüne Plastikfetzen schwammen. Zwischen Aststücken und Baumwurzeln lagen die Lederriemen auf dem erodierenden Boden, der sich in sanftem Gefälle zum Ufer der Oder senkt.
Obwohl auf der deutschen Stromseite gelegen, trägt Stiegliz nebenher auch einen polnischen Namen, Tiblice. Dieser Name, den die allherbstlich von jenseits der Oder anreisenden Erntearbeiter in Umlauf gebracht haben, ist den Stieglizern aufs Äußerste verhasst, und wer gedankenlos von Tiblice statt von Stiegliz redet, muss mit scharfer Zurechtweisung und fanatischen Darlegungen rechnen: Seit jeher sei Stiegliz ein rein deutscher Flecken, und gerade heute sei Stiegliz unverzichtbarer Teil eines Bollwerks... und so weiter und so fort.
An jenem Morgen des 18. Juni waren die Stieglizer noch frühzeitiger als gewöhnlich auf den Beinen. Sie alle hatten sich an der Anlegestelle versammelt, wo ihre Boote vertäut lagen, und palaverten über die Verwüstungen der Nacht. Als der Junge gegen sechs Uhr dreißig bei weiterhin scharfem Ostwind unweit der Bootslände ans Ufer getrieben wurde, bemerkte zunächst niemand, dass dies, anders als die entwurzelten Bäume, losgerissenen Hüttenwände oder Rumpfstücke zertrümmerter Fischerboote, die unaufhörlich vorüberjagten, ein menschliches Treibgut war. Dabei war der Junge zu diesem Zeitpunkt noch immer am Leben.
Er lag bäuchlings auf einer Bohle, die er mit beiden Armen umklammert hielt. Erst als eine seitlich anbrandende Welle ihn für einen Augenblick anhob, dann mitsamt seinem Brett zurück ins Schilf sacken ließ, wurden die Stieglizer Bauern aufmerksam und liefen die etwa zwanzig Schritte bis zu der Stelle, wo der Schwerverletzte lag.
Der Junge war schwarzhaarig, von gedrungener, kräftiger Gestalt, etwa sechzehn Jahre alt und vollkommen nackt. Sein Körper war mit Brandwunden und entzündeten Insektenbissen, mit Messerschnitten und entwürdigenden Tätowierungen übersät. Mit der rechten Hand umklammerte er den Stumpf eines Astes, der unter der Bohle hervorragte.
»Der ist von drüben.« Der alte Karl Cramsen deutete mit dem Stock auf die andere Oderseite. »Hat versucht, bei diesem Sturm den Strom zu überqueren – saudummer Polack!«
»Aber siehst du denn nicht«, widersprach der fettleibige, nahezu glatzköpfige Knut Lauber, immerhin der Bürgermeister von Stiegliz, »wie sie ihn zugerichtet haben?«
»Bandenkriege«, knurrte Cramsen.
»Dreht ihn mal um. Vorsicht!«, befahl Lauber.
Während weiterhin der Ostwind durchs Schilf pfiff und den Männern Gischt in die Gesichter blies, bückten sich zwei der jüngeren Stieglizer Bauern, packten den Jungen bei den Schultern und drehten ihn um. Da er die Bohle umklammert hielt, lag er nun rücklings unter dem schlammigen Brett wie unter einem Sargdeckel, den er mit beiden Händen, dabei den Aststumpf mit der Rechten festhaltend, an seine Brust, auf sein Gesicht zu pressen schien. Sie entwanden ihm den Ast und bogen seine Arme auseinander. Was unter der Bohle zum Vorschein kam, war so entsetzlich, dass die Umstehenden zurückprallten, als ob vor ihnen die Erde ihr schlammiges Maul geöffnet hätte.
Gurgelnd strömte die Oder vorüber, und noch immer führte sie Kadaver und Baumgerippe mit sich und sogar einen Holztisch, zwischen dessen himmelwärts gereckten Beinen ein verdutzt blickendes Wolfsjunges saß.
Das Gesicht des Jungen war offenbar verbrüht oder mit Säure übergossen worden. Es war eine blutrote, rohfleischerne Scheibe, mit lidlosen Augen, die so stark verdreht waren, dass man nur das Weiße der Augäpfel sah.
»Der ist hin«, murmelte Cramsen.
Im gleichen Moment bewegte der Junge seine Augen. Sein Mund öffnete sich mit krampfhaftem Zittern, doch kein Laut drang hervor. In der zahnlosen Mundhöhle zuckte der Stumpf seiner Zunge, die (wie sich später herausstellte) mit einer Zange abgekniffen worden war.
Als sich der Junge erhob, wichen die Stieglizer Bauern zurück wie vor einer teuflischen Erscheinung. Wenigstens eine halbe Minute verharrte er auf Knien und Händen; dann stemmte er sich hoch und stand schwankend, schlammbedeckt neben seiner Bohle, einer bereits verwesenden Leiche ähnlicher als gleich welcher lebendigen Kreatur.
Er streckte die Arme vor und machte mehrere Schritte auf die Stieglizer Bauern zu, die im gleichen Takt rückwärts liefen, gegen die Bootslände, wortlos, dabei mit großen Augen auf den Auferstandenen starrend. Nach genau fünf Schritten brach der Junge, in dessen Brust der nur teilweise lesbare Schriftzug Un...e...ch eingeritzt war, zusammen und blieb rücklings im Uferschlamm liegen.
Bekanntermaßen verfügt Stiegliz, in dessen ausgedehnten Schilfflächen alljährlich Enten, Schwäne und sogar Reiher nisten, weder über Arzt noch Hebamme und nicht einmal über eine Pastorei. Daher rannte der schwergewichtige Lauber, der als Erster die Besinnung wiederfand, gegen sechs Uhr fünfzig zu seinem Häuschen und verständigte die Polizeidienststelle von Lebus.
Als siebzig Minuten später der Notarzt eintraf, war der junge Pole unwiderruflich tot. Auf Anordnung der Polizei wurde er abermals als Leiche abtransportiert, diesmal im amtlichen Zinksarg.
2
Am Vormittag des folgenden Tages, als längst wieder frühsommerlich milde Witterung herrschte, stoppte der Polizei-Lada auf dem grasüberwucherten Schotterplatz vor dem Tor von Schloss Stiegliz, einem ruinenhaften Anwesen in teilweise klassizistischem Stil, das sich im Wäldchen oberhalb von Dorf Stiegliz vor einem zauberhaften, vollständig verwilderten Park erhob.
Lauber hatte es sich nicht nehmen lassen, Kriminalkommissar Zirfas zum Verhör zu begleiten. Dieser drahtige Polizeibeamte, ein elegant wirkender Endfünfziger in grauem Zivilanzug, war schon seit Jugendtagen mit dem gleichaltrigen Knut Lauber befreundet. Im Jahr 1990 hatten sie, wie mancher andere, zwischenzeitlich Schwierigkeiten bekommen, doch nach kurzzeitiger Abwesenheit waren sie mit untadeligen Personalakten an ihre alten, geringfügig umbenannten Posten zurückgekehrt. Auch der fuchsbärtige, fünfzehn Jahre jüngere Wachtmeister Worzak, der den grün-weiß umlackierten Lada Kombi steuerte, gehörte seit langem zu Zirfas’ Truppe, deren Parole nun »Neues Denken alter Schule« lautete.
Auf einen Wink von Zirfas stieg Worzak aus und rüttelte an der in Kinnhöhe angebrachten Klinke. Das Tor, wenigstens vier Meter hoch und mit schorfigem Eisen beschlagen, war fest verschlossen. Worzak packte den eisernen, an einem rostigen Ring kopfüber aufgehängten Schlegel und ließ ihn gegen das Tor dröhnen.
Mit seiner schnörkellosen, obwohl stockfleckigen Hofmauer, in die schwarz vergitterte Fensterscharten eingelassen waren, machte Schloss Stiegliz einen abweisenden, nahezu wehrhaften Eindruck. Hinter der Hofmauer ragte das Hauptgebäude auf, flankiert von den Treppentürmen, die das eigentliche Schloss mit den Seitenflügeln verbanden. Das Schieferdach zwischen den Türmen sah schadhaft aus und wirkte eigentümlich verrutscht. Seit Jahrzehnten bröckelte der Putz von den Fassaden des Schlosses, das einst ein herrschaftlicher Landsitz gewesen und in den Fünfzigerjahren von seinen damaligen Besitzern verlassen worden war.
»Keiner zu Hause«, sagte Zirfas, indem er sich auf dem quietschenden Plastikbezug des Beifahrersitzes umwandte. »Was jetzt?«
»Das hier ist mein Dorf, Hans.« Lauber, der bereits wieder heftig schwitzte, zog eine griesgrämige Grimasse. »Ich kann dir von jedem einzelnen Stieglizer sagen, wann er sich mit wem trifft, um welche Stunde er zur Arbeit geht, wann er zurückkommt, sein Freizeitverhalten ...«
»Weiß ich doch, Knut. Hundertfach bewiesene Solidarität. Wo ist das Problem?«
»Dieser Prohn«, sagte Lauber, gegen das Schlosstor deutend, vor dem Worzak wie eine Schildwache stand, »ist für mich ein Rätsel. Er hat seine Kindheit auf Schloss Stiegliz verbracht – vor mehr als vierzig Jahren. Sein Vater war dieser Gutsherr, den wir damals enteignet haben, wie es heute heißt. Den Prohns gehörte all das hier«, er breitete die Arme aus, »das Schloss, die Wälder, die Felder – das ganze Dorf. 1953 ging die Familie in den Westen, und jetzt – jetzt ist dieser Sohn wieder da. Und prozessiert. Gegen mich, das heißt: gegen die Kommune. Er will alles zurückhaben.«
»Und seine Chancen?«
»Mal so, mal so. Ein verrückter Kerl, Hans. Letzte Woche hat er mir einen Vergleich angeboten: Er will auf die Hälfte verzichten – die Wälder, die Felder –, wenn er nur das Schloss mitsamt dieser vergammelten Bibliothek kriegt und die Orangerie und den Park. Ein sentimentaler Narr, wie er selber sagt, außerdem Künstler, was immer das heißen soll.«
»Also gut«, sagte Zirfas. Er machte Worzak ein Zeichen. »Und wo finden wir jetzt diesen verrückten Kerl? Der muss doch auch schon über fünfzig sein, oder?«
»Dreiundfünfzig«, bestätigte Lauber, während Worzak, der seinen Rübezahlbart zur neuen Uniform kürzer gestutzt trug, hinter das Steuer zurückkehrte. »Wir haben ein gentlemen agreement getroffen ...«
»Ein was?« rief Zirfas, da Worzak, der in diesem Moment startete, gewohnheitsmäßig den Motor aufheulen ließ.
»Ein gentlemen agreement«, wiederholte Lauber mit nahezu russisch klingender Aussprache, »hätte nicht gedacht, dass Prohn sich dran hält. Ich habe ihm – vorläufig – genehmigt, dass er in der Orangerie wohnen darf, bis das Gericht entschieden hat, wem dieser alte Kasten gehört.«
»Und wenn du gewinnst?«
»Ich mach ein Hotel draus«, sagte Lauber mit schwärmerischem Augenaufschlag. »Immer die Mauer entlang, Worzak, wir fahren nach hinten zum Parktor, das ist in Sichtweite der Orangerie.«
Im Schritttempo folgten sie einem schmalen Waldweg, der nach dem nächtlichen Unwetter schlammbedeckt und mit abgerissenen Ästen übersät war. Mehrfach musste Worzak stoppen und größere Aststücke zur Seite wuchten, was ihm Spaß zu machen schien. Ehe er den Ast packte, spuckte er jedes Mal in die Hände.
Nach etwa hundertfünfzig Metern knickte die Mauer rechtwinklig nach links ab, und der Waldweg verbreiterte sich zu einer ehemals pompösen Allee. Obwohl sie in Zeitlupe dahinkrochen, rüttelten die Stoßdämpfer in knöcheltiefen Schlaglöchern, aus denen Wildblumen, Disteln und Hafer sprossen.
»Hier ist es«, sagte Lauber.
Worzak stoppte vor dem Parktor, das aus verrosteten schmiedeeisernen Stangen bestand, die sich oben speerartig zuspitzten. Hinter dem Gitter dehnte sich ein weitläufiger Park, mit sanft gewellten, wenigstens kniehohen Wiesen und uralten Buchen, überwiegend Rotbuchen, die gruppenweise beisammen standen. Während links im Hintergrund, auf einem überwucherten Hügel, die verrottete Rückfront von Schloss Stiegliz zu sehen war, erstreckte sich rechter Hand der lang gezogene, in der Mitte von einer türkisfarbenen Kuppel gekrönte Flachbau der Orangerie.
»Wohnt im Glashaus?« Zirfas schubste Worzaks Hand vom Steuerrad und drückte auf die Hupe.
Auf dieses Zeichen hin tauchten hinter dem Torgitter gleich drei Gestalten auf. Von der Schlossseite her, in großer Entfernung und von Zirfas unbemerkt, schlenderte eine rothaarige junge Frau in wallendem schwarzem Kleid durch die Wildwiese auf die Orangerie zu. Während hinter der Glasfront das blasse Gesicht einer erschrocken wirkenden weiteren Frau sichtbar wurde, grüßte der »Künstler und sentimentale Narr« lächelnd von einem Söller in Höhe der Kuppel herab, wozu er ausrief:
»Einen Augenblick, Herr Bürgermeister, ich komme sofort!«
3
Sein Blick haftete noch am Parktor, wo der Polizeiwagen mit laufendem Motor stand. Unter ihm glitzerte der halbmondförmige Vulkansteinplatz, den sein Vater vor fast fünfzig Jahren mit »nordischem Magma« hatte aufpflastern lassen. Timo erinnerte sich genau an jenen für immer unvergesslichen Abend wenig nach der feierlichen Einweihung des Magmaplatzes: Damals war er fünf Jahre alt, eben groß genug, um die Arme auf die Brüstung des Söllers zu stützen, und hinter sich fühlte er seine Mutter, die sich wie schützend oder Schutz suchend gegen ihn drängte, während unten im nächtlichen Park, angestrahlt von einem halben Tausend brennender Fackeln, das unerhörte Schauspiel begann: ein Konzert mit Flöten, Streichinstrumenten und einem ebenso vielstimmigen Knabenchor. Musik nur, aber von einer tonalen Gewalt, wie Timo sie seither niemals mehr gespürt hatte – nicht eigentlich schön, doch überwältigend noch in der Erinnerung, sodass jede Faser seines kindlichen Körpers zu vibrieren, selbst zur Saite zu werden schien. Vor ihnen, über ihnen wie eine dunkel ragende Wand, wie eine zerfurchte steinerne Maske, herabstarrend aus achtzig erleuchteten Fensterhöhlen, das riesenhafte Schloss, das Timo, während er sich bereits abwandte, für einen Moment mit den Augen seiner Frau Lisa zu sehen glaubte: eine schwarzgraue Ruine, modernd, und die schadhaften Kuppeln der Treppentürme wie ausgerenkte Schulterkugeln; das ganze grandios zerfallende Gebäude wie ein zerstörter Leib, über dem verwilderten Park hingeworfen und schmerzhaft verkrümmt... Unsinn, dachte er.
Über die metallene Wendeltreppe, durch den Urwald aus Kletterpflanzen, die sich an Stahlsäulen in die Orangeriekuppel rankten, lief er nach unten, die Sohlen seiner Schlangenlederstiefel klapperten auf den Stufen wie damals, und die ganze Treppenspirale zitterte noch immer, während Timo bereits über den zersprungenen Steinboden zur Glastür ging, deren Flügel weit geöffnet waren.
Schräges Sonnenlicht, verfärbt durch das wuchernde Grün und das teilweise blutfarbene Baumlaub, ergoss sich durch die Glaswände und das Türloch in die Orangerie. Auf halbem Weg blieb er stehen. Die Orangerie war ein Chaos aus Pflanzen und Gärtnereigerümpel und notdürftig in Nischen geschobenen Möbeln – dem mit Papieren, Büchern, Kladden überhäuften Schreibtisch an der Schmalwand rechts von ihm und linker Hand dem breiten Bett, vor dem immer noch Lisa stand, über Koffer gebeugt, in die sie Wäsche, Kleider, gerahmte Bilder warf.
»Du bekommst Besuch?« Sie schaute ihn nicht einmal an.
»Lauber – du kennst ihn ja.« Bleib bei mir, Lisa, wollte er flehen, fahr nicht zurück; aber draußen am Parktor erschallte die Hupe des Polizeiwagens: ein quäkender Misston, der Lisa zusammenzucken ließ. Ihre schmalen Schultern, ihre blasse Haut, dachte er, bleich und kontrastlos unter dem fahlblonden Haar und dem mattweißen, ärmellosen Kleid. »Warte wenigstens, bitte, bis Lauber und diese Polizisten...«
Da wandte sie sich langsam um zu ihm, und ihr Blick war ohne Zorn, müde und doch entschlossen wie ihre Worte: »Ich habe es versucht, Timo, du weißt es, aber ich kann hier nicht leben. Was zu sagen war, haben wir gesagt« – gebrüllt, geschrien, geweint, ergänzte er in Gedanken –, »und jetzt ist es genug: Ich fahre.«
Vorbei an der zerfurchten schwarzen Ledercouch, die seit unvordenklichen Zeiten vor der Wendeltreppe in der Orangerie stand, ging er auf Lisa zu, die sich bereits wieder über ihre Koffer beugte. Wie gestern Abend schon hatte er das Gefühl, als ob etwas in ihm zerreißen, ihn auseinanderreißen wollte, und er spürte, wenn der Bruch wirklich unvermeidlich würde – dass er eher mit Lisa brechen würde als mit Stiegliz, mit dieser verwunschenen Welt, die er nie wirklich verlassen, die ihn seit jeher begleitet hatte, vierzig Jahre lang, wo auch immer er sich scheinbar aufhielt, die ihn seit jeher umschloss wie ein von Flüsterstimmen, von Gerüchen und Bildern erfüllter Turm.
Er stand jetzt dicht hinter Lisa. Als er seine Hand auf ihre linke Schulter legte, fühlte er, dass sie weinte. In der Nacht, dachte er, hatten sie miteinander geschlafen, als ob gar nichts wäre; sie hatten sich geliebt wie ein durchschnittlich vertrautes Paar. Mit dem Körper lügen, dachte er, aber was bedeuten diese Wörter: Lüge, Körper, Paar. Tatsache jedenfalls war, dass Lisa noch an diesem Vormittag zurückfahren würde, in das andere, das westliche Frankfurt, wo er sich immer fremd, heimatlos, wie zufällig ausgesetzt gefühlt hatte, trotz seines kleinen Fotoateliers, das während all dieser Jahre leidlich florierte (Timotheus Prohn – Atelier für adelnde Werbe-Ästhetik), und trotz ihres Reihenhäuschens am östlichen Stadtrand, das sich nur durch die aufgeschraubte Hausnummer von den Nachbarhäusern unterschied.
Abermals der Hupton. Seine Hand rutschte von Lisas Schulter; er stopfte die Fäuste in seine Jeanstaschen, wandte sich um und trottete nach draußen. Damals, vor drei Jahren, hatte er sich geschworen, er würde alles, sofort alles opfern, wenn er nur dieses Schloss, wenn er nur Stiegliz, seine Kindheitswelt, zurückbekam. Aber er hatte niemals daran gedacht – bis gestern Abend nicht –, dass zu diesen Opfern möglicherweise auch Lisa zählen würde, seine Frau, die er vor zehn Jahren geheiratet hatte, an einem stürmischen Herbsttag in jenem anderen, westlichen Frankfurt, das in seiner Erinnerung schon zu verblassen, sich aufzulösen begann.
+++
»Prohn? Herr Timo Prohn?« Zirfas musterte ihn mit einem langen Blick aus wasserblauen Augen, die infolge vieljährigen Verdachtschöpfens verdüstert schienen.
»Timotheus.« Er überreichte dem zackig wirkenden Polizisten seinen Ausweis, den er stets in der Geldbörse mit sich trug, und Zirfas vertiefte sich in die Plastikkarte.
Mittlerweile standen sie auf dem halbmondförmigen Vulkansteinplatz, direkt vor der Glastür zur Orangerie. Der Bürgermeister hatte ein weißes Taschentuch gezückt, mit dem er sich mehrfach über die Glatze fuhr, während der fuchsbärtige Worzak in der Haltung eines Wachsoldaten nahe dem Parktor neben seinem Wagen verharrte.
»Dreiundfünfzig?«, wiederholte Zirfas, wobei er seinen Blick zwischen Prohn und dem Plastikbild schweifen ließ. »Sie sehen erheblich jünger aus, Herr Prohn.«
»Ja und nein«, sagte Timo mit einem Lächeln, das keineswegs Zirfas galt. »Ich wurde 1939 geboren, das lässt sich nicht leugnen, und trotzdem bin ich jung. Alles eine Frage der Willensstärke und der Richtung, in die man seinen Willen lenkt. Und was mich betrifft – ich bin reinweg vernarrt in die Jugend, in all das hier...« Wahllos deutete er auf einige Bäume, die Rückfront des Schlosses, die in der Sonne blinkende Fassade der Orangerie. »Ende eines langen Winters«, sagte er, »alles ist wieder aufgetaut, und das Spiel beginnt wieder genau dort, wo es vor vierzig Jahren abgebrochen wurde. Und deshalb bin ich zurückgekommen in das Schloss meiner Kindheit, wie Ihnen der Herr Bürgermeister zweifellos längst erklärt hat.«
Hinter der Glasfront, mit Wiesen-, Schloss-, Himmelsspiegelungen vermischt, war schemenhaft, halb verdeckt durch die Äste und das dunkle, nahezu schwarzgrüne Laub der gewaltigen Kletterpflanzen, die schmale Gestalt Lisas zu erkennen, die noch immer Kleidungsstücke zusammensuchte und in weitere Koffer warf. Gerade mal drei Wochen hatte sie es hier mit ihm ausgehalten, dachte Timo; dabei hatten sie vorher von einem dauerhaften Umzug gesprochen, von einem Abbrechen aller Westbrücken, aller Gegenwartsbrücken geträumt. Aber das war nur sein Traum, musste er jetzt erkennen, sein kostbarer, unvergänglicher, Wirklichkeit werdender Wunschtraum, dagegen für Lisa ein unheilvoller Wahn. »Da gibt es eine Grenze, dahinter ein Land der Schatten«, hatte sie erst gestern wieder gesagt, mit weiter Gebärde Schloss und Park umfassend. »Dort ist alles wie bei uns, wie in der vertrauten Welt, und doch anders, verzaubert, auf grauenvolle Weise verwandelt: die Nachtseite...« Einer dieser rätselhaften Sätze des romantischen Dichters Novalis; ein Zitat, das Timo im Zusammenhang mit Schloss Stiegliz keineswegs angemessen fand.
»Weshalb sind Sie eigentlich gekommen?« Abrupt wandte er sich wieder Zirfas zu. »Wollen Sie mich jetzt mit Polizeigewalt aus meinem eigenen Schloss werfen lassen, Herr Lauber?«
»Apropos Jugend«, sagte Zirfas, während der Bürgermeister unbehaglich grimassierte, »in einem Waldstück drüben am Fluss, das Sie vor Gericht als Ihr Eigentum reklamieren... Sie wissen, wovon die Rede ist?«
»Will ich gar nicht mehr haben.« Müde fühlte er sich, nervös, dabei noch immer, wie seit anderthalb Jahren, getragen von dieser Euphorie der Rückkehr, des Anknüpfens und Neubeginns. »Genauer gesagt«, erläuterte er, »ich bin sofort bereit, auf dieses Waldstück zu verzichten, wenn der Herr Lauber mir im Gegenzug ...«
»Darum geht es jetzt nicht.« Zirfas’ Stimme klang kalt und verhörerprobt. »In dem besagten Wäldchen wurde in der Nacht zum 18. Juni ein junger Pole bei lebendigem Leib begraben. Was sagen Sie dazu?«
»Das sind Gräuelgeschichten, Herr Zirfas, daran glaube ich nicht. Natürlich, so etwas kommt vor – bei Edgar Allan Poe oder vielleicht auch bei mir ...«
»Das heißt?«
»Nicht in der Wirklichkeit«, sagte Timo, während er mit versteckter Verblüffung beobachtete, wie Margot Wegener auf halber Höhe des Schlosshügels auf einer morschen Bank Platz nahm. Wie kommt Margot hierher? Seit dem letzten Winter (eine Nacht, an die er sich ungern erinnerte) hatte er sie nicht mehr gesehen. Rasch wandte er sich Zirfas zu, dabei im Augenwinkel beobachtend, wie Margot ihre faszinierende kupferrote Mähne aus der Stirn strich und ihr nonnenhaftes, allerdings durchbrochenes schwarzes Kleid bis über die Knie schob, offenbar in der Absicht, ihre Beine in der Junisonne zu bräunen.
»Herr Prohn ist ein Künstler, wie gesagt«, erklärte Lauber, »er fotografiert, und er beabsichtigt, ein Buch über Stiegliz zu schreiben.«
»Das ist neuerdings erlaubt«, warf Timo ein.
»Der Junge hieß Karoly Zigorsky«, sagte Zirfas mit leiernder Stimme, »er war sechzehn Jahre alt und stammt aus dem polnischen Babimost. Dort wurde er am 29. Mai von seinem Vater als vermisst gemeldet. Den Namen schon mal gehört?«
»Karoly.« Mit ausdrucksloser Miene erwiderte Timo Zirfas’ Blick. Dabei war er furchtbar erschrocken, einmal mehr hatte er das Gefühl, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten, aber das ging diesen automatenhaft wirkenden Polizeioffizier nichts an.
Karoly...
Natürlich kannte er den Jungen, seit Jahren und sehr viel besser als diese Margot Wegener, die ausgerechnet heute hier auftauchen musste – am selben Tag, an dem seine Frau Lisa ihn womöglich für immer verließ. »Aber er ... lebt?«
»Nein.« Zirfas zog einen schmalen Packen Fotografien aus der Jackentasche. »Er wurde regelrecht geschlachtet und dann wie ein Tier verscharrt. In seinem Grab kam er noch einmal zu sich. Und so sah er aus – vorher.« Er flipperte die Bilder durch und reichte ihm eine zerknickte Fotografie, die Karoly zeigte, wie Timo ihn tatsächlich gekannt hatte: unter störrisch sich sträubendem schwarzen Haar ein lachendes, slawisch breites Jungengesicht, das mit optimistischem Blick in die Welt sah. »Sie haben übrigens Besuch? Aus dem Westen?«
»Meine Sache.« Mit der Schuhspitze zog er einen imaginären Kreis auf dem Magmaplatz. Die Schuhe waren aus extraweichem Schlangenleder, graubraun wie sein Haar, das er in gewissen Abständen färbte. »Also gut – ich kannte den Jungen.«
Zirfas pfiff leise durch die Zähne, dabei warf er Lauber einen tadelnden Blick zu. Der Bürgermeister hob die Schultern: Von diesem Logiergast auf Schloss Stiegliz hatte er nichts gewusst.
»Das müssen Sie uns schon etwas genauer erklären.« Zirfas packte Timo bei der Schulter, mit barschem Griff, als ob er ihn zuführen wollte; doch der weiche Stoff des olivgrünen Seidenhemdes schien ihn zu irritieren: Auch sein Griff wurde gleich wieder weich und rutschte ab.
»Karoly hat von kleinen Schmuggeleien gelebt«, sagte Timo, dabei insgeheim immer wieder Margot beobachtend, die oben auf der morschen Bank ihr Kleid bis zu den Hüften hochstreifte. Metallisch glänzte in der Sonne ihr Haar, und womöglich war es der Anblick dieses kupfernen Funkelns, der ihn veranlasste, in die Offensive zu gehen. »Karoly war ja nicht der Einzige«, sagte er zu Zirfas, »da gibt es eine ganze Bande junger Polen, die regelmäßig durch die Wälder schleichen, dann nachts über die Oder und auf unserer Seite wieder durch die Wälder – übrigens bewundernswert, wie viel Mut diese Burschen aufbringen: bei Nacht und Nebel durch die Wolfsregion.«
»Unsinn!« Diesmal war es Lauber, der ihm mit erhobener Stimme ins Wort fiel. »Hier gibt es weit und breit keine Wölfe, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wenigstens nicht auf unserer Seite.«
»Ach so? Jedenfalls – das Schloss war ja lange Zeit unbewohnt, und ehe ich zurückkam, wurde es von den Schmugglern als Warenlager benutzt: Zigaretten, Würste, Ersatzteile für Autos und was weiß ich noch. Eines Tages, das muss jetzt schon ein halbes Jahr her sein, ertappte ich Karoly, wie er vorn im Südflügel durch eine Fensterluke in den Keller schlüpfte. Was zu trinken, die Herren?«
»Gerne – nein«, korrigierte sich Lauber, da Zirfas finster den Kopf schüttelte.
»Und wie jetzt weiter?« Der Polizist fing an, ihm auf die Nerven zu gehen.
»Wie weiter?«, echote Zirfas. »Das hängt ganz davon ab, was Sie uns noch alles erzählen. Auf jeden Fall haben Sie sich strafbar gemacht: Begünstigung. Sie hätten Ihre Beobachtung melden müssen.«
»Ich hätte die Beobachtung nicht einmal machen dürfen«, korrigierte Timo. »Dank Lauber hatte ich beim damaligen Stand meines Prozesses Haus-, das heißt Schlossverbot.« Als er bei dem Wort Schloss, das für ihn einen unauslöschlichen Zauberklang hatte, zur Rückfront seines Elternhauses schaute, bemerkte er beunruhigt, dass Margot von der Bank verschwunden war. Allerdings flatterte ihr Kleid im leichten Wind auf der Lehne, wie eine Fahne, die zur Anarchie rief.
»Also Begünstigung und Hausfriedensbruch, Verstoß gegen eine richterliche Verfügung«, zählte Zirfas auf, während er neuerlich in seinen Fotografien blätterte. »Hätten Sie den Jungen angezeigt, wäre er eingesperrt oder abgeschoben worden. Jedenfalls wäre er heute noch am Leben. Und so sah Zigorsky nachher aus.«
Während er auf die scharf ausgeleuchtete Aufnahme blickte, die Zirfas ihm unter die Nase hielt, spürte Timo, wie Übelkeit in ihm aufstieg.
»Folter, Tätowierung mit Dolchen, Drogenmanipulation, Säure«, sagte Zirfas. »Er wurde verschleppt, vor genau drei Wochen, direktemang vom väterlichen Acker in Babimost. Irgendwohin, an einen geheimen Ort, zum Beispiel ...«
»Zum Beispiel hier? Wollten Sie das sagen?« Immer wieder blickte er auf die schauerliche Fotografie, und seine Stimme hörte sich belegt an.
»Werden wir sehen«, sagte Zirfas, Jagdgier im Blick, »wir krempeln das ganze Schloss um, noch heute, und wenn wir ...«
»Aber das geht nicht, Hans!«, rief Lauber in flehentlichem Ton. »Alle Zugänge zum Schloss wurden ja gestern versiegelt, vom Gerichtsvollzieher – tut mir leid, fällt mir erst jetzt wieder ein.«
Zirfas warf ihm einen Blick zu, der noch vor wenigen Jahren unbefristete Lagerhaft bedeutet hätte.
»Das stimmt, was er sagt«, bestätigte Timo, »das Gericht teilt die Befürchtung des Bürgermeisters, dass ich mir widerrechtlich unsere Familienbibliothek aneignen und mit fünftausenddreihundert Bänden im Handgepäck über Nacht verschwinden könnte.«
Unterhalb der Bank, an deren Lehne Margots Kleid flatterte, bemerkte er ein langes Frauenbein, das sich mit lasziv wirkender Trägheit zwischen Gräsern und Wildblumen anwinkelte und streckte.
»Also gut«, sagte Zirfas, »wenden wir uns Ihrem geheimnisvollen Gast zu, der sich seit zwanzig Minuten dort drinnen versteckt hält.« Er drängte sich zwischen Lauber und Timo Prohn hindurch und trat ohne weitere Umschweife in die Orangerie.
4
Auf dem Hügel unterhalb von Schloss Stiegliz, versteckt hinter einer Rotbuche, die sich in Kniehöhe wie eine riesige Hand in fünf Stämme zergliederte, belauerte Margot seit den Morgenstunden die Orangerie.
Sie hatte ihren Auftrag. Am späten Abend war sie losgefahren in ihrem Alfa Spider, Frankfurt/Main – Frankfurt (Oder) fast nonstop, und seitdem spürte sie diesen Kitzel, der sie vorwärts peitschte, dieses Kribbeln in ihrem Körper, den Stachel, nach dem sie süchtig war: Abenteuer, Verhängnis, unkontrollierbare Gefahr.
Im Morgengrauen, nahe dem Falkenberg bei Fürstenwalde, war sie in das Unwetter geraten: der Himmel ein Netz aus Blitzen, dazu Donnerstöße wie Faustschläge, wie Stiefelschritte aufständischer Gladiatoren, während Sturzfluten sich auf die Straßen, in die Wälder, über ihrem nachtschwarzen Spider ergossen. Kurzer Stopp am Fuß des Falkenbergs, einem Sandhügel von allenfalls sechzig Metern Höhe, der aus der brettflachen Landschaft aufragte wie ein wirklicher Berg. Die Mondsichel, durch die weichen Kuhbäuche der Wolken schneidend. Und im akustischen Wirrwarr des Gewitters immer wieder etwas wie Schreie, verzweifelte Rufe, dann zwei- oder dreimal ein lang gezogenes, jäh abbrechendes Jaulen, ein gierig die Oktaven emporjagender Heulton: Wölfe...
Einen Moment lang war sie versucht, einfach auszusteigen, hinauszulaufen in die Zaubernacht, in das elektrische Chaos, in dem sich zertrümmernde, übernatürliche Mächte bekämpften, entluden, dann trügerisch versöhnten. Aber sie war weitergefahren, sehr langsam, mit schaufelnden Scheibenwischern, mit klopfendem Herzen, gezogen von den Lichtseilen ihrer Scheinwerfer, durch glitzernde Wasserrinnen; links und rechts der wind- und regengepeitschte Wald. Dann wieder märkische Dörflein und Städtchen, schwarze Hausruinen, nirgendwo Licht in den Fenstern, alles wie ausgestorben, wie fluchtartig verlassen unter dem Eindruck einer übermächtigen Gefahr. Die tief hängenden, mit triefenden Fingern nach ihr greifenden Äste der Alleebäume, die mit kratzendem Geräusch über das Dach ihres Spider streiften, und immer wieder die löchrigen Dorfsträßchen im Schein peitschenförmiger Straßenlaternen, die sich aus einer anderen, boshaften Epoche in die Gegenwart zu biegen schienen.
Gegen sechs Uhr früh, in einem Waldweg neben dem Ostflügel von Schloss Stiegliz, hatte sie ihren Wagen, der vor Hitze knackte, hinter Wildrosengestrüpp versteckt. Der Wald dampfte, und auf diesem Dampf ein Schillern von rötlich aufsteigender Sonne, ein Funkeln wie von bunt gefärbten Splittern; das Laub der Büsche und Bäume umwirkt mit Spinnengefädel, darauf die Tropfen wie Perlen aufgereiht. Die Schreie der Morgenvögel. Das Seitentürchen in der bröckelnden Mauer zum Wirtschaftshof war versiegelt. Ohne nachzudenken, brach Margot das amtliche Siegel auf und schlüpfte in den mit Gestrüpp und Gerümpel zugewucherten Hof.
Erinnerungen an jene Winternacht vor sechs, sieben Monaten, als sie mit den Männern des Neuen Bundes auf Schloss Stiegliz war. Sie schauderte, das war die morgendliche Kühle; zwischen verrotteten Erntewagen, zerbrochenen Traktorachsen, Dreschflegeln, die aus Dornenranken ragten, huschte sie südwärts, wo der Wirtschaftshof in den Park von Schloss Stiegliz überging. Hinter sich spürte sie die ungeheure Steinmasse des verlassenen Schlosses, wie eine Riesenfaust, die sie vorwärts stieß, in die Tiefe, hügelab in den Park, der sie mit der anschmiegenden Nässe kniehoher Gräser empfing. Sie schlüpfte aus ihren Sandalen. Ihre Schritte rauschten in der Wiese, ihr Kleid sog sich mit Tautropfen voll und wurde schwer und klebrig, eine zweite, schwarze, durchscheinende Haut.
Die Stille dieses Parks. Seine Verwunschenheit. Die hohen, gewellten, bunt getupften Wiesen, nass und grün und tief wie ein zweites Meer. Darin die Bäume, uralte, schrundige, zum Himmel ausgreifende Buchen, überwiegend Blutbuchen, vereinzelt oder wie verschwörerisch in kleinen Gruppen, und schwarzrot ihr tropfendes, dampfendes Laub. Sie glaubte zu singen, ihre Gedanken zu hören, Gedanken wie Melodien, aber das waren die Vögel, die in den Bäumen, im Gestrüpp erwachten zu einem tausendstimmigen, sinnverwirrenden Gesang: Jubel, Klage, Chaos, Begierde... Drunten, in der Tiefe, über der kupfergrünen Kuppel der Orangerie ging pathetisch, feuerfarben die Sonne auf.
Auf halber Höhe des Schlosshügels, kaum hundert Meter über der Orangerie, bezog Margot Posten hinter der Rotbuche, die sich in Kniehöhe zu fünf gewaltigen Stämmen gliederte, was in der Tat an eine aus der Erde gereckte Hand denken ließ. Dass Timo Prohn neuerdings mit einer Frau auf Schloss Stiegliz lebte, war im ersten Moment eine Enttäuschung, dann spürte sie den Zorn, den Hass auf diese Frau. Es war noch nicht einmal halb sieben, doch die Orangerie machte den Eindruck, als hätten ihre Bewohner während der Nacht kaum geschlafen. Hinter der Glaswand ging die Frau hin und her, in verbissen wirkender Geschäftigkeit, während Timo (nur mit schwarzen Boxershorts bekleidet) hinter ihr herlief mit beschwörenden Gebärden, zu denen die Frau immer wieder nur den Kopf schüttelte: stumm, entschlossen, aber entschlossen wozu?
Margot witterte zur Orangerie hin. Sie begann zu begreifen, was dort unten vorging und wer diese Frau hinter der Glaswand war. Schmale Gestalt, sehr viel schmaler als sie selbst, geradezu schlankheitsbesessen, und das fahlblonde, glatte Haar kurz geschnitten: sportlich, streng. Auf Fotografien hatte sie diese Frau schon gesehen: Lisa, mit Timo Prohn verheiratet seit zehn Jahren. Fotos, die zu ihrer Mission gehörten, die man ihr gezeigt hatte, damit sie informiert war soweit wie nötig, damit sie Freunde von Feinden unterschied.
Er ist isoliert, hatte es geheißen, von Gegnern umgeben, in seinem Kampf ganz allein. Aber das stimmte nicht, diese Information war offenkundig veraltet, oder doch nicht? Plötzlich verstand sie: Lisa packte ihre Sachen.
Die Sonne, kaum aufgegangen, erzeugte bereits eine stechende Hitze. Die Wiesen dampften; es war schwül wie in einem Treibhaus, in dem die beiden da unten tatsächlich lebten. Und Margot beobachtete: wie Lisa vor dem breiten, selbst aus dieser Entfernung zerwühlt wirkenden Bett niederkniete und mehrere Koffer hervorzog. Wie Timo gestenreich auf sie einredete, dann zu seinem Schreibtisch an der linken Schmalwand trottete, wo er sich in einen Stapel großformatiger Schriftstücke vertiefte: vielleicht Akten aus seinem Prozess um Schloss Stiegliz, vielleicht Skizzen zu seinem Buch über Stiegliz, an dem er (falls zumindest diese Informationen stimmten) seit einigen Wochen schrieb.
Ein gut aussehender Mann, dachte Margot hinter der Rotbuche, schlank, hochgewachsen, dem man seine dreiundfünfzig Jahre keineswegs ansah. Sein glattes Gesicht, das beinahe weich wirkte, der offene, obwohl verträumte Blick seiner braunen Augen unter dem (wahrscheinlich gefärbten) gleichfalls braunen Haar. Die Stärke seines Körpers, der ihr einmal nah gewesen war (doch dann war Timo geflohen, oben aus dem Schloss, in jener Winternacht). Und seine Besessenheit, die er zu verbergen verstand und die sie dennoch spürte, eine Art liebenswürdiger, dabei zu allem entschlossener Verrücktheit, die Margot roch, die sie vom ersten Moment an gewittert hatte wie einen besonderen Körperduft.
Sie beobachtete und wartete. Immer wieder trat Timo vor die gläserne Wand und starrte zum Schloss hoch, als ob er sich von der ruinenhaften, steinernen Masse Inspiration oder Kraft erhoffte oder als fürchtete er, das Schloss könne jählings verschwinden wie ein Trug. Mehrfach lief er sogar drinnen auf der von Kletterpflanzen umschlungenen Wendeltreppe bis unter die Kuppel und trat oben auf den winzigen Söller, wo er in andächtige Betrachtung des noch im Schatten liegenden Schlosses und des sonnenüberfluteten Parks versank.
Gegen halb zehn erst beschloss sie, Timo zu sich heraufzulocken, auf den Schlosshügel, in die wuchernde Wiese, hinter den Buchen-Fünfling, während Lisa unten im Glashaus ruhig weiter ihre Kleider und Wäsche falten und verstauen mochte. Provozierend nahm sie auf der morschen Holzbank neben der Rotbuche Platz; ihr Herz klopfte. Sie wusste, dass Timo sie früher oder später bemerken würde, und dann...
Dann fuhr völlig unerwartet dieser Polizeiwagen vor. Margots Herz begann zu rasen. Ihre Kehle fühlte sich plötzlich trocken und rau an, und sie begriff, dass sie nicht mehr imstande war, das Spiel zu stoppen. Während Timo sich unten auf dem Vulkansteinplatz mit dem feisten Bürgermeister Lauber und mit einem in grauem Zivil auftretenden Polizisten unterhielt, ließ sich Margot in die dampfend warme Wiese unterhalb der morschen Bank gleiten, wo sie ihr Kleid auszog. Nackt bis auf einen knapp geschnittenen schwarzen Slip, rekelte sie sich im feuchten, vor Insekten summenden Gras, und ihr Kleid flatterte über ihr an der Lehne der Bank wie eine Fahne. Und dann allerdings fuhr sie hoch, als sie unten die Schläge mehrerer Autotüren hörte:
Lisa startete, mit Prohns sandfarbenem Peugeot fuhr sie ohne weiteres davon. Kurz darauf traten Timo, der dicke Lauber und der hagere Polizeioffizier aus der Orangerie. Der uniformierte Polizist, der die ganze Zeit über statuengleich gewartet hatte, rollte mit dem Lada bis vor die Orangerie, wo er wendete und die drei Männer einsteigen ließ. Dann fuhr auch der Polizeiwagen davon, über den knirschenden Kiesweg zum Parktor, das ebenso offen blieb wie die Tür zur Orangerie.
Margot streifte ihr Kleid, ihre Sandalen über und rannte über den Hügel nach unten, auf den Vulkansteinplatz: Niemand mehr da. Sie schaute nach links und rechts; dann huschte sie ins Glashaus.
5
Die Landstraße von Lebus über Stiegliz nach Frankfurt schmiegte sich den Windungen des Grenzstroms an, allerdings in einer Distanz von einigen hundert Metern, sodass von der Straße her die Oder nur hier und dort zwischen den Bäumen in der Ferne schimmerte. Dieser östlichste Streifen Brandenburgs war noch immer eine einsame, scheinbar von aller Welt vergessene Gegend, ein spärlich besiedelter Landstrich aus Staub, Heidekraut und Sand, in dem nur Birken und Lärchen wurzeln konnten, eine am Rand lichte und flimmernde, in der Tiefe dickichthaft sich verfinsternde, mit Gestrüpp und Geschling und tückischen Sandmulden drohende Waldeinsamkeit. Allerlei Gelichter trieb hier sein Wesen: Schmuggler und Schlepper von jenseits der Oder, dann allerdings auch manövrierfreudige Freunde altdeutschen Brauchtums, und die Jäger und Förster berichteten voller Sorge, dass sich in den brandenburgischen Lärchen- und Birkenwäldern selbst der vor Jahrzehnten ausgerottete Grauwolf und der Mähnenwolf wieder anzusiedeln begannen.
Auf der schmalen Asphaltschneise in diesen Wäldern raste der Polizei-Lada mit asthmatischem Röhren auf das Grenzstädtchen Frankfurt zu. Obwohl die Straße erst im Vorjahr überteert worden war, begann sich das alte Katzenkopfpflaster bereits wieder hervorzuwölben, und die Achsfedern des russischen Wagens rüttelten ächzend über den ackerartigen Belag.
Mittagszeit nahte. Die vier Insassen schwiegen, mit rotbehaarten Händen umklammerte Worzak das Lenkrad, als ob er es zerquetschen wollte. Hin und wieder donnerten überalterte Lastzüge bulgarischer oder polnischer Herkunft an ihnen vorbei, Sandwolken aufwirbelnd, die der Luft einen bernsteinfarbenen Schimmer verliehen. Scheinbar interessiert beobachtete Kriminalkommissar Zirfas, der wieder neben Worzak Platz genommen hatte, wie sie beiderseits der Straße Scharen von Vögeln aus den Bäumen aufscheuchten und vor sich hertrieben. Im Fond neben dem Bürgermeister, der wieder und wieder sein Taschentuch aus der Jacke nestelte und sich über Hals und Glatze fuhr, saß Timo Prohn in düsteren Gedanken, die abwechselnd um Lisa und Karoly kreisten und sich zwischendrin zum Überfluss auch noch zu Margot Wegener verirrten.
Karoly, der angeblich auf grässliche Weise ermordet worden war – ein Irrtum, ein Missverständnis vielleicht. Aber er fühlte, es war kein Irrtum, es war genau das eingetreten, was er seit Monaten befürchtet, wovor er (in Träumen, in Gedanken) Karoly immer wieder gewarnt hatte. Abermals sah er die Fotografie vor sich, die Zirfas ihm gezeigt hatte, und wieder wurde ihm übel. Gewaltsam wandte er seine Gedanken von Karoly ab.
Vor einer halben Stunde gen Westen abgereist – Lisa, in ihrem sandfarbenen Peugeot, den sie wenige Wochen nach ihrer Hochzeit zusammen gekauft hatten. »Was habe ich mit diesem Polenjungen zu tun?« Wie sie Zirfas ins Gesicht gelacht hatte, mit einer Kälte, einer Bitterkeit, die in Wahrheit ihm galt, ihrem Mann Timo, der »um eines verrückten, kindischen Traums willen« ihre Existenz ruiniert, ihre Ehe zerstört hatte. »Das sind seine Freunde!« Anklagend hatte sie auf Timo gedeutet, dann hatte sie ihre Koffer geschnappt, in den Peugeot geworfen und war abgereist. Ohne ein weiteres Wort, ohne Kuss, ohne Abschied, einfach so. Nicht daran denken. Sie wird zurückkommen, bald schon; aber er ahnte, dass er all das hier würde aufgeben müssen – das Schloss, seinen Traum –, um Lisa zu versöhnen. Und dass er niemals die Kraft aufbringen würde, sich noch einmal von Stiegliz loszureißen: Selbst wenn er seinen Prozess verlor, selbst wenn alle Welt sich gegen ihn verschwor, er würde Mittel und Ausflüchte, er würde seinerseits Verbündete finden, um notfalls gewaltsam... Ruhig, ermahnte er sich, alles wird gut.
Und Margot? Seine Gedanken fanden an diesem wunderschönen Junitag einfach keinen Ruhepunkt. Die geheimnisvolle, erschreckende, gefährlich bezaubernde Margot, die unversehens im Park von Schloss Stiegliz aufgetaucht war, wie eine Erscheinung, die glücklicherweise nur er bemerkt hatte. Oder? Jetzt nicht daran denken, auch hieran nicht, ermahnte er sich – und schon gar nicht an jene Winternacht, als sie...
Mit einer scharfen Drehung wandte er seinen Kopf nach rechts, wo die Bäume in rasendem Taumel vorübertanzten, und spürte ein Stechen zwischen den Schultern, das sich wie ein Pfeil durch sein Genick bis in den Schädel bohrte. Der ständige Streit mit Lisa, sein Prozess wegen des Schlosses mit Lauber, mit der Gemeinde Stiegliz, mit wankelmütigen, überforderten Richtern und undurchsichtigen Sachverständigen, die wie Fadenpuppen auf der Bühne des Gerichtes auf- und wieder untertauchten, und das seit nunmehr eineinhalb Jahren... Neben sich hörte er Lauber schnaufen wie einen Dämon. Eben fuhren sie mit unverminderter Geschwindigkeit über die nördliche Grenze des Oderstädtchens, dessen Bürger seit Monaten ihre Häuser und Wohnungen nach Einbruch der Dunkelheit tunlichst nicht mehr verließen.
Durch Lauber ohnehin beengt, rollte Timo vorsichtig mit den Schultern, um seine Muskeln zu lockern. Seit Wochen wachte er in beinahe jeder Nacht gegen drei, vier Uhr morgens auf, mit einem Schrei, beklommen, unter schweißfeuchten Laken, bedrückt von Bildern, die sich, wenn er sie festzuhalten suchte, wie Nebelfetzen auflösten: Grauen, das zu seinen Erinnerungen zu gehören schien, allerdings so wie ein furchterregender Burgwächter, der Tor und Brücke bewacht. Seine Nerven waren ramponiert, seine Muskeln vollkommen verspannt, und immer häufiger erlebte er diese quälenden Momente, in denen ihn ein unkontrollierbares Zittern überlief – wie bei einem Weinkrampf, der allerdings regelmäßig ausblieb, obwohl ihn in solchen Augenblicken eine tiefe Traurigkeit befiel.
Er durfte sich keinen einzigen Fehler erlauben. Vorläufig war er auf Schloss Stiegliz lediglich geduldet, und der Bürgermeister – aber keineswegs nur Lauber allein – lauerte auf den Moment, da er in eine der zahlreichen Fallen, die sie für ihn aufgestellt hatten, tappen würde. In den zurückliegenden Monaten hatte er ein Gespür entwickelt für das Gewirr widerstreitender und größtenteils wohlmaskierter Interessen, das wie ein Netz über Schloss Stiegliz gesponnen war. Paktierst du mit diesen, machst du dir jene zum Feind. Stimmst du hier einem verlockenden Kompromiss zu, verlierst du dort unversehens an Boden, stürzt in eine dieser tückischen Sandmulden und versinkst bis zum Hals.
Bis zum Hals, echote es in ihm, während sie im Schritttempo bereits die Kreuzung vor der Oderbrücke überquerten, die wie immer wegen des turbulenten Grenzverkehrs verstopft war. Dutzende überladener Polski-Fiats summten wie flügellahme Insekten aus dem überdachten Brückenschacht hervor, während Timo dachte:
Aber das ist es nicht, der endlose Prozess nicht, auch nicht der sinnlose, immer in die gleichen Wunden sich einbohrende Streit mit Lisa – das alles ist es nicht, was meine Nerven kaputt macht, was mich aus dem Schlaf auffahren lässt, schreiend, was mir die Ruhe raubt, den Frieden, was an meiner Euphorie frisst, mit der ich nach vierzigjährigem Albtraum hierher zurückgekehrt war. Aber was dann? Für einen Moment sah er abermals Margot vor sich, die Zauberin, mein Verhängnis, ahnte er: wie sie durch die hüfthoch mit Wildblumen überwucherte Wiese von Park Stiegliz auf ihn zukam, in ihrem schwarzen, knöchellangen Kleid, mit ihrem wallenden, immer ein wenig an Trance erinnernden Gang, mit ihrem Lächeln, ihrer kupfern funkelnden Mähne, ihren hypnotisch braunen Augen – als käme sie aus einer Welt, dachte er, in der scheinbar alles wie in der vertrauten Welt war, und doch ganz anders, auf unergründliche Weise verwandelt: aus der Nachtseitedieser Wirklichkeit...
Schluss jetzt mit diesen Gedanken!, befahl sich Timo, während Worzak scharf abbremste und über die Schwelle des Rolltors auf den Hof vor dem Leichenschauhaus von Frankfurt (Oder) fuhr.
+++
Auf einer Holzbank im Flur saß weinend ein polnisches Bauernpaar: ländliche Gesichter, Mitte Fünfzig, gekrümmt, greisenhaft, mit eisfarbenem Haar.
»Die Eltern des kleinen Polen«, sagte Zirfas über die Schulter zu Lauber und Timo, die hinter ihm durch den Gang hasteten. »Sie weigern sich, die Leiche zu identifizieren.«
Der Flur mündete auf eine milchgläserne Tür mit der Aufschrift Rechtsmedizin. Dahinter ein weiter, grau gekachelter Raum, und in einer Ecke, vor dem verhängten Fenster: die Metallbahre, hochbeinig, auf Gummirädern; in der Luft ein Geruch von Asepsis, Vergeblichkeit.
Mit einem Ruck zerrte Zirfas das Leintuch von der Bahre: »Und? Ist er’s?«
Sofort wandte Lauber sich ab.
»Nein ... vielleicht«, murmelte Timo, »ich ... glaube schon.« Wieder klang seine Stimme belegt. Aber da half kein Räuspern, da blieben keine Zweifel, keine Ungewissheit, über die sich hinwegräuspern ließe: Es war Karoly. Er hatte kein Gesicht, keine Lider, keine Zunge mehr, doch Timo erkannte den Jungen an der Narbe.
Auch er wandte sich ab und rannte nach draußen, durch die Milchglastür, vor der Karolys Eltern saßen, noch immer weinend, und im Vorbeilaufen nickte er ihnen hölzern zu. Auf dem Vorplatz vor dem Leichenhaus blieb er stehen und wartete: nicht auf Zirfas, er wartete auf den Bürgermeister.
»Was ich Ihnen jetzt sage, werde ich niemals vor diesem Zirfas oder vor irgendeinem Polizisten wiederholen.« Er zog Lauber mit sich über die belebte Hauptstraße, zur Kneipe gegenüber, die – wie auch anders – Letzte Hoffnung hieß. »Ich weiß genau, dass Zirfas das ausschlachten, verdrehen, mir letzten Endes anhängen würde, und wie Sie begreifen werden, Herr Bürgermeister, kann eine solche Entwicklung nicht in meinem Interesse sein.«
Die Kneipe war nahezu leer. Sie bestellten Radebeuler, setzten sich an einen Ecktisch, und während sich Lauber mit seinem Tuch über Gesicht und Glatze wischte, fuhr Timo leise fort:
»Was wissen Sie von den Dingen, die oben auf Schloss Stiegliz geschehen? Von geheimen – oder gar nicht so sehr geheimen – Zusammenkünften, die begonnen haben, lange bevor ich hierher zurückgekehrt bin? Sie zucken die Schultern? Sie sind ein Philosoph, Herr Bürgermeister, denn zweifellos ist Ihnen bewusst, dass Ahnungslosigkeit in bestimmten Fällen dem Wissen vorzuziehen ist. Prost! Aber ich wollte Ihnen von Karoly erzählen, dem armen Kerl dort drüben in seiner Eisschublade, dessen Gesicht nur noch ein blutiger Brei ist.«
Und er erzählte es ihm, und obwohl er ja sah, wie Lauber sich wand, wie er seinem Blick auswich und am liebsten die Flucht ergriffen hätte, zwang er den Bürgermeister, sich alles anzuhören – oder doch einen Teil dieser Geschichte, der Geschichte von Karoly, der eines Abends im Dezember 1991 zu ihm gekommen war.
»Blutend«, sagte Timo, »er humpelte, sein Gesicht war geschwollen, und er behauptete, er sei im Dunkeln auf dem Waldhang gestürzt. Dabei war es eindeutig, dass er verprügelt worden war, und nicht nur verprügelt: eine klaffende Wunde an seiner linken Hüfte, vorn; seine Hose zerfetzt und darunter der glatte Spalt, aus dem Blut quoll: wie von einem Axthieb oder von einem Dolch, aber eine Wunde, die man sich nicht bei einem Kampf zuzieht.«
Sie hatten ihn festgehalten, zu zweit, und der Dritte hatte von der Seite her mit einer Klappaxt zugeschlagen. Kastriert die Polacken, eine Parole, die man schon seit Längerem an den Hauswänden von Lebus, von Frankfurt, sogar von Dorf Stiegliz las. Karoly wand und sträubte sich unter dem Griff seiner Peiniger, und als ihn der hastig geführte Hieb traf, riss er sich los und stürzte davon, den Waldhang hinab, rutschend, taumelnd, sich überschlagend, durch die Trümmer der Ostmauer von Schloss Stiegliz in den Park, dann immer stärker humpelnd bis zur Orangerie, wo er Timos Namen rief, zweimal, mit verzerrter Stimme, ehe er auf dem Vulkansteinplatz zusammenbrach.
»Trinken Sie noch ein Bier, Herr Lauber?« Er bestellte, ohne eine Antwort abzuwarten, zwei weitere Radebeuler, während eine Gruppe schwarz gekleideter Leichenträger in die Kneipe trat. »Zumindest«, sagte er zu Lauber, »hat Karoly, als ich ihm einige Wochen später diese Version der Geschichte erzählte, nicht widersprochen, mich nur aus großen Augen angesehen: ein gescheiter Junge, und dass ich kein Wort Polnisch spreche, hat uns nie gestört. Wenn ich langsam, in einfachen Sätzen, mit ihm sprach, verstand er jedes Wort.«
Er hatte Karoly damals – stümperhaft, mit den einfachsten Mitteln – verarztet. Die Wunde gereinigt, einen Pressverband angelegt. Und ihn drei Wochen lang in der Orangerie versteckt, hinter einem Vorhang, bei schärfster Kälte, da es ihm für den Jungen im Schloss zu unsicher geworden war.
Wieder prostete er dem Bürgermeister zu, der bedrückt und regelrecht alarmiert wirkte.
»Warum... ich meine, weshalb wollen Sie das alles nicht auch Zirfas erzählen?«
»Ich weiß noch nicht genau, wessen Spiel Sie spielen, Herr Lauber, ob Sie beispielsweise das Schloss wirklich nur deshalb versiegeln ließen, damit ich nicht mit der Bibliothek durchbrennen kann. Aber zumindest glaube ich zu wissen, dass Ihr Freund Hans Zirfas, ehemals ...«
»Ich muss jetzt wirklich gehen«, warf Lauber hastig ein. Er stemmte sich hoch. »Ich habe nichts gehört, gar nichts, kein Wörtchen, und es wäre besser...«
Der Rest war nicht zu verstehen, da Lauber, während Timo sein Radebeuler leerte, fluchtartig die Letzte Hoffnung verließ.
6
Gleich rechts im Eingang der Orangerie, auf einer zersprungenen Marmorscheibe, die ihrerseits auf rostigen Metallfüßen ruhte, hatte Timo zwei überdimensionale, gegen fünf Jahrzehnte alte Einmachgläser aufgestellt. Ein sonderbarer Altar, dachte Margot, die durch die Orangerie lief und immer wieder wie magnetisiert zu den bauchigen Gläsern zurückkam. An Urnen fühlte sie sich erinnert, wobei allerdings das transparente Material seltsam indiskret wirkte, schamlos beinahe, wie die Gefäße, krötenartig auf dem Marmor hockend, ihren Inhalt zur Schau stellten: ockerbraunen, mit Klumpen durchsetzten märkischen Sand.
In diesen Gläsern hatte Timo vor mehr als fünfundvierzig Jahren Laub- und Ochsenfrösche gehalten, in großer Zahl und zum Schrecken seiner Mutter, die über die eigentümliche Fähigkeit verfügte, sich in nahezu jeder Lage und selbst vor den friedvollsten Erscheinungen maßlos zu fürchten. Alle Lieder seiner Kindheit, die die Mutter ihm und seinem Bruder Kai vorgesummt, vorgeträllert und -gesungen hatte, waren Melodien der Angst, Gesänge des Grauens, Partituren der Panik gewesen; aber davon und vom Geheimnis dieser Gläser wusste Margot nichts. Sie wandte sich ab vom Altar der bauchigen Urnen; mit ihrem trancehaften Gang schritt sie zur linken Schmalwand und fing an, Timos Schreibtisch zu erforschen.
Im ramponierten Wechselrahmen eine Collage, halb Fotografie, halb Kohlezeichnung: Timo und Lisa als ernst blickendes Paar vor der Orangerie von Schloss Stiegliz; darunter drei rätselhafte Zeilen in runder, zweifellos weiblicher Schrift (Lisa?):
»Wie zauberisch diese Glaswand spiegelt:
Wer hindurch späht, sieht nach draußen
und mehr noch in sich selbst hinein.«
Margot las die Zeilen mehrmals, dann drehte sie das Bild mit den ernsten Gesichtern zur Glaswand. In einem Schubfach fand sie einen Karton, in diesem ein dickes Bündel großenteils zerknickter und vergilbter Fotografien. Die Sonne flutete durch die Wände, sie flimmerte im Laub der riesenhaften Kletterpflanzen, die sich längs der Eisentreppe in die Kuppel rankten, und Margot setzte sich auf den Drehstuhl vor Timos Schreibtisch und wühlte in den alten Fotografien.
Irgendwo in der Orangerie, vielleicht hinter dem kreisrunden, turmförmigen Vorhang vor der Stirnwand, der Dreiton eines Telefons, den Margot ignorierte. Sie blätterte in den Fotografien, die Schloss Stiegliz zeigten, wie es vor zweiundfünfzig, vor achtundvierzig Jahren war: ein herrschaftliches Anwesen, die Fassade strahlend, der Park ein Muster geschorenster, peinlichster gärtnerischer Ordnung, doch schon damals wirkte das Schloss abweisend wie ein Wächter, der ein düsteres Geheimnis hütet. Das Telefon verstummte.
Sie wusste längst, dass Timo ein sogenannter Designfotograf war, der im anderen, im westlichen Frankfurt sein Geld mit kostbaren Kamerainszenierungen verdient hatte, die allerdings überwiegend Werbezwecken dienten. Aber diese gilbfleckigen Bilder hatte ein anderer aufgenommen: Immer wieder zeigten sie auch Timo als Jungen, stets in der damals noch prachtvollen Kulisse von Schloss und Park Stiegliz vor fast fünfzig Jahren. Träumerisch fragend im Alter von vier oder fünf, düster blickend mit sieben, hochaufgeschossen, doch nahezu steinern schauend mit zwölf oder dreizehn Jahren. Und auf allen diesen Bildern, an seiner Seite, nicht nur die furchtsam in die Kamera blickende hellhaarige Frau, sondern ein weiterer Junge, fast im gleichen Alter wie Timo, aber ohne familiäre Ähnlichkeit: weizenblond und störrisch gelockt neben dem dunklen, brav gescheitelten Schopf von Timo, eine kraftvolle Gestalt schon als Kind, neben der Timo geradezu schmächtig wirkte.
Dazu der Blick des Blondgelockten: hypnotisch, ein Blick, der sich in das Gegenüber förmlich einwühlte und doch zugleich kalt und abweisend schien. Obwohl die braun-gelblichen Bilder die wirklichen Farben verfälschten, war sich Margot sicher, dass der Augenton dieses Jungen (ein Mann längst, ungefähr im Alter von Timo) ein intensives Meergrün war.
Der Grünäugige, Blondgelockte, von dessen Blick sie nicht loskam: Timos verschollener Bruder, wer denn sonst? Doch aus irgendeinem Grund waren sie um keinen Preis bereit, ihre Warnung ernst zu nehmen, wenigstens anzuhören: dass dieser Bruder (der Grünäugige, Hypnotische) womöglich noch am Leben war. Plötzlich spürte Margot einen beißenden Zweifel. Sie warf die Fotografien in den Karton, knallte ihn auf die mit Papieren überhäufte Schreibtischplatte und sprang auf.
Bildest du dir wirklich ein, zischte in ihr eine boshafte Stimme, dass sie dich für ihre Sache brauchen: ausgerechnet dich? Ihre Augen verdunkelten sich, ihr Blick wurde fahrig: als ob in dieser Orangerie ein Beweis versteckt wäre, etwas, das ihre Mission über jeden Zweifel belegte. An der überwucherten Wendeltreppe, an dem furchigen, uralten Ledersofa vorbei lief sie durch den von der Sonne erleuchteten Raum, auf das zerwühlte Bett zu, während die Stimme weiter zischelte: Kann schon sein, Hexe, dass du ihnen nützlich bist. Aber glaubst du im Ernst, dass sie nicht auch ohne dich ihr Ziel erreichen?
Margot stöhnte unter der Wirkung ihrer inneren Stimme. Neben dem Bett bemerkte sie einen Schwenkspiegel, der in einem Rädergestell aufgehängt war und mit weißem Tuch verhüllt. Sie zerrte das Tuch weg und trat so nah vor den Spiegel, dass er unter ihrem Atem, der Wärme ihres Körpers beschlug. Dabei streifte sie ihr Kleid ab; minutenlang starrte sie in das Glas. Mit den gespreizten Fingern beider Hände fuhr sie rückwärts durch ihre Mähne, so blieb sie stehen, skulpturhaft, mit emporgereckten Armen, und ohne ihre Lippen zu bewegen, antwortete sie der Stimme in ihrem Innern: Ohne mich kommen sie nie zum Ziel.
Während abermals der Dreiton des Telefons durch die Orangerie schallte, bückte sich Margot und zog unter dem weißen Tuch ein helles, glockig geschnittenes Kleidchen hervor. »Das hast du vergessen, Lisalein.« Sie streifte das Kleid über, das für ihren üppigeren Körper zu eng war, auch entschieden zu kurz: ein prall sitzendes, gerade durch seinen biederen Schnitt obszön wirkendes Hurenkostüm.
Margot feixte in den Spiegel, dann lief sie um die Wendeltreppe herum zur Stirnwand der Orangerie, streifte den Vorhang beiseite und fand in einem Chaos aus Büchern und Wäsche das noch immer quäkende Telefon – einer jener drahtlosen Apparate, kaum größer als eine Zigarettenschachtel, die auf Knopfdruck Tastatur und Mikrofon freigeben. »Ja?«, sagte sie atemlos.
»Mein Name ist Robert Trowal«, erwiderte eine Stimme, die seltsam gepresst klang, »ich möchte Herrn Prohn sprechen.«
»Herr Prohn ist nicht da, ich erwarte ihnin ... etwa einer Stunde.«
»Ich rufe wieder an«, sagte der Mann hastig und legte im gleichen Moment auf.
Als gehörte genau das zu ihrer »Mission«, kehrte sie ohne weiteres Nachdenken zu Timo Prohns Schreibtisch zurück, wo sie neuerlich den rissigen Karton öffnete. Stapelweise zog sie Fotografien hervor, und in Lisas Kleid trat sie vor die linke Schmalwand der Orangerie und fing an, die Glaswände mit den Bildern zu schmücken, die Schloss Stiegliz, Timo und den Grünäugigen vor vierzig, vor drei-, vor siebenundvierzig Jahren zeigten. Behutsam schob sie die Fotografien in die Fugen zwischen rostigen Metallrahmen und blindfleckigem Glas, und sie brauchte Stunden, bis sie alle Bilder aus dem Karton an den Glaswänden befestigt hatte. Draußen dämmerte bereits der Abend.
Zwischendurch nochmals das Telefon: wiederum die gepresst klingende Stimme, die sich Trowal nannte. »Herr Prohn jetzt zu sprechen?« Er war offenbar sehr nervös.
»Tut mir leid, ich weiß auch nicht, wann er ...«
Wieder legte er unvermittelt auf.
Sie kehrte zum Schreibtisch zurück, zog einen weiteren Karton hervor, und auch dieser Karton enthielt Stapel großformatiger Fotografien, die sie in die Furchen aus bröckelndem Fensterkitt klemmte: Bilder von Karoly, in Schwarz-weiß und in Farbe, immer wieder Karoly, sein Lächeln, sein dunkler Blick unter gesträubtem schwarzem Haar. Sie arbeitete methodisch, in Lisas Kleidchen reckte sie sich immer höher vor den gläsernen Wänden empor, und nachdem sie das letzte Karoly-Bild neben dem größten Foto des Grünäugigen befestigt hatte, warf sie sich auf die schwarze Ledercouch, legte ihren Kopf mit dem flutenden Kupferhaar auf die Seitenlehne und betrachtete nur noch diese beiden Bilder: den Blondgelockten, Hypnotischen, Grünäugigen, daneben den Schwarzhaarigen, Lachenden mit den slawisch breiten Wangenknochen, beide vielleicht im Alter von vierzehn, fünfzehn Jahren, beide in Park Stiegliz, der hier ein Muster ausgesuchtester gärtnerischer Ordnung, dort eine hüfthoch wuchernde Wildnis war.
Andreas Gößling, 1958 in Gelnhausen geboren, hat Germanistik, Politikwissenschaft und Publizistik studiert und 1984 mit einer Dissertation über Thomas Bernhards Prosa promoviert. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter literaturwissenschaftliche Werke, kultur- und mythengeschichtliche Sachbücher und Romane für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Andreas Gößling hat einen Sohn und lebt als freier Autor mit seiner Frau Anne Löhr-Gößling bei Berlin.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783944488516458270
- Artikelnummer SW9783944488516458270
-
Autor
Andreas Gößling
- Verlag MayaMedia Verlag
- Veröffentlichung 04.08.2020
- ISBN 9783944488516