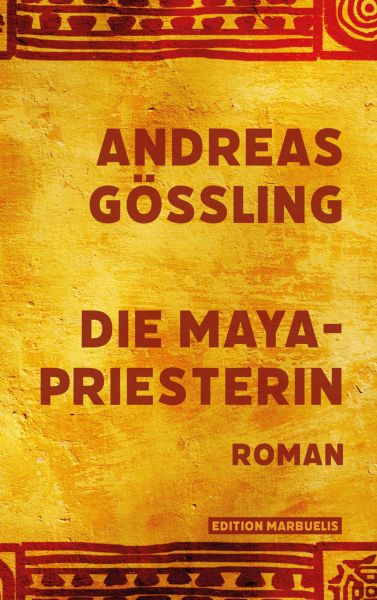Die Maya-Priesterin
1696 A.D.: Weil er eine junge Frau vor den Häschern der Inquisition versteckt hat, wird der spanische Franziskanermönch Diego Delgado zum Missionsdienst im mittelamerikanischen Dschungel verurteilt. Dort gerät er in die Wirren eines Aufstands gegen die weißen Eroberer und verliebt sich heillos in die Maya-Priesterin Ixkukul. Er folgt ihr ins letzte freie Reich der Maya, das tief im Urwald verborgen den Siegeszug der Konquistadoren überdauert hat. Die Pracht der Tempel und Pyramiden von Tayasal fasziniert ihn ebenso sehr, wie ihn die grausamen Kulte und Rituale verstören. Diego wird als Bote der Götter verehrt, mit dem Tode bedroht und stößt auf ein Geheimnis, das er unbedingt lösen muss, um sein Leben zu retten und die Liebe der schönen Ixkukul zu erringen. Oder ist alles ganz anders – wird er benutzt in einem Spiel, in dem es um Macht und Rache statt um Leben und Liebe geht?
»Sinnlich, mysteriös, grausam und bis zur letzten Zeile fesselnd.« (Gisbert Haefs)
»Gössling gelingt das narrative Kunststück, Wissenswertes zu vermitteln und zugleich seine Leser zu unterhalten.« (Jochen Hörisch, NZZ)
Andreas Gößling
Die Maya-Priesterin
Roman
Edition Marbuelis - Band 3
(c) Edition Marbuelis im Verlag MayaMedia, Berlin
Prolog
Plötzlich stand sie vor ihm, in einer Gasse am Rand von Santo Pedro. Pater Tomas erkannte sie sofort. Dabei hatte er sie zuvor nur ein einziges Mal gesehen, vor weit mehr als einem Jahrzehnt. Doch seither war kein Tag vergangen, an dem er nicht an sie gedacht hätte. Sie verwünscht oder herbeigesehnt. Sein Schicksal verflucht und den unerbittlichen Monsignore Batisto, der ihn vor so langer Zeit auf diesen Posten tief im Urwald beordert hatte. »Ganz einfach, mein Lieber.« Niemals würde er die Worte des vatikanischen Agenten vergessen. »Ich ernenne dich zum Nachfolger von Pater Diego. Du lässt dich in Santo Pedro nieder, weidest deine braunen Schäfchen und hältst im Übrigen die Augen offen. Du wirst sehen, Tomas, über kurz oder lang taucht sie in deinem Sprengel auf.«
Das war noch vor der Jahrhundertwende gewesen, im Herbst 1696 A. D. Und nun stand sie tatsächlich vor ihm, nach beinahe vierzehn Jahren. Sie ist älter geworden, natürlich, dachte der Pater, aber sie ist immer noch schön.
Er starrte sie an, unfähig, seine Verwirrung zu verbergen. Soeben war sie aus dieser ärmlichen Hütte getreten, gewandet in die weiße Tunika des alten Volkes. Vor ihrer Tür lag allerlei Hausrat aufgehäuft. Offenbar hatte sie wahrhaftig beschlossen, sich in Santo Pedro niederzulassen. Nicht anders als Giovanni Batisto es damals vorausgesagt hatte. Pater Tomas mochte es kaum glauben. Oh gütiger Gott, dachte er, so wird sich doch alles noch zum Guten wenden.
Einen Moment lang erwiderte sie seinen Blick, mit unbewegter Miene. Dann wandte sie sich zu ihrer Behausung um. »Ixbalanqué, Huhnapú, wo bleibt ihr denn?« Ihre Stimme klang melodisch und ein wenig rau.
Zwei Halbwüchsige traten aus der Hütte, Junge und Mädchen. Erstaunt sah Pater Tomas die beiden an. Natürlich, dachte er, damals war sie schwanger, das hatte er deutlich gesehen. Zumal sie dort am Kai von Tayasal vollkommen nackt gewesen war. Aber er hatte niemals in Betracht gezogen, dass sie Zwillinge zur Welt bringen könnte.
Der Junge bückte sich nach einem der Bündel, die vor der Hütte am Boden lagen. Er war von knochigem Wuchs, seine Haut so hell wie Milchkakao. Das Mädchen dagegen hatte das dunkle Braun, die rundliche Anmut ihrer Mutter geerbt. Es warf dem weißen Mann in der knöchellangen Soutane einen neugierigen Blick zu, dann ergriff es einen Tonkrug und verschwand in der Hütte.
Pater Tomas blieb allein auf der Gasse zurück. Die Mittagssonne brannte herab. Huhnapú und Ixbalanqué, dachte er. Warum diese archaischen Namen? Und wieso kam sie nach so langer Zeit ausgerechnet hierher? War sie des Dschungels überdrüssig geworden? Oder glaubte sie, sich nicht länger verbergen zu müssen, fast vierzehn Jahre nach dem Fall von Tayasal?
Tief in Gedanken kehrte er zu seinem Kirchlein zurück, das er noch im Winter 1696 auf dem Hauptplatz von Santo Pedro hatte errichten lassen. Die plötzliche Begegnung mit der Frau, die sich Ixkukul nannte, verwirrte ihn mehr, als er sich eingestehen mochte. Ob sie ihn erkannt hatte? Sicherlich nicht, dachte er. Schließlich war er damals nur ein unbedeutender Gefolgsmann gewesen, inmitten einer ganzen kastilischen Armee. Wie sollte er nun vorgehen? Er musste Monsignore Batisto benachrichtigen, zweifellos. Der Agent des Heiligen Vaters hatte niemals die Hoffnung aufgegeben, dass Ixkukul eines Tages in irgendeiner Siedlung des Petén auftauchen würde.
Pater Tomas stieß die Kirchentür auf und eilte durch den dämmrigen Altarraum. Hier war es angenehm kühl, der Dschungel scheinbar fern. Unter dem Bildnis des Gekreuzigten sank er auf einen Schemel. Fast ein Drittel seines bisherigen Lebens hatte er auf diesem elenden Posten ausgeharrt, der gemeinhin Verbannten wie jenem Pater Diego vorbehalten war. Doch die Zeit seiner Prüfung neigte sich dem Ende zu. Wenn er nun keinen Fehler machte. Als Erstes musste er Ixkukuls Vertrauen gewinnen. Sie musste ihm die ganze Wahrheit gestehen. Monsignore Batisto hatte ihn damals in das furchtbare Geheimnis eingeweiht. Die Andeutungen des vatikanischen Agenten ließen nur einen Schluss zu. Jahrtausendelang hatten die Mayapriester einen Wissensschatz gehütet, den nur der Höllenfürst selbst ihnen offenbart haben konnte. Niedergelegt in dem uralten Buch, das Ixkukul aus Tayasal entwendet hatte – just an dem Tag, als Batisto und er mit einem halben Tausend kastilischer Soldaten in die letzte freie Mayastadt eingeritten waren. Wo sie zu ihrem Erstaunen keine kampfentschlossenen Verteidiger vorfanden, sondern Zehntausende von Totenschädeln. Und einen jungen Maya, der in reinstem Kastilisch behauptete, der Christenpater Diego Delgado zu sein.
Was für eine Geschichte, dachte Tomas. Als er aufsah, fiel sein Blick auf die vergoldete Statue der Mater Maria. Vor der Gottesmutter sank er auf die Knie. »Du Trostreiche, schenke mir Kraft und Zuversicht.« Wie matt ihm die vertraute Formel auf einmal schien, wie hohl sie in seinen eigenen Ohren klang. Pater Tomas hob den Blick empor. Doch wie lieblich Maria auch lächelte, ihre sonst so strahlenden Augen schienen ihm verdunkelt von Trauer und Hoffnungslosigkeit.
»So ist es also wahr?« Er flüsterte es. »Wird der Satan über die Kirche Christi siegen?« Der Kopf sank ihm auf die Brust. »Oh mein Gott.« Grauen erfüllte ihn, und er wagte es nicht, den Blick noch einmal zu erheben, als fürchte er, dass auch das Lächeln der Gottesmutter über ihm erloschen sei.
Eins: San Benito
1
Seit Stunden lagen sie schon vor Anker, eine Meile vor San Benito. Ohne den Fahrtwind war es unerträglich heiß, aber der Lotse, der ihre Karavelle in die Bucht dirigieren sollte, ließ auf sich warten.
Fray Diego Delgado saß achtern unter dem Sonnensegel und fächelte sich mit einem Brief Luft zu. Der Brief war ein Antwortschreiben seines alten Freundes Pedro Martínez, Abt des Klosters zum heiligen Franziskus, das etliche Meilen landeinwärts am Ufer des Rio Hondo lag. Pedro hatte versprochen, ihn in San Benito abzuholen und persönlich zur Missionsstation zu geleiten, drei Tagesmärsche tief im Regenwald. Fray Diego hatte den Brief gerade noch erhalten, ehe er sich vor drei Wochen, am 7. März 1696 A. D., mit Kurs auf Neuspanien einschiffte.
Der gute Pedro, dachte der Mönch, er hätte es dem Abt nicht einmal verübeln können, wenn der ihm die Freundschaft aufgekündigt hätte. Immerhin hatte das bischöfliche Kirchengericht zu Malaga ihn mit einem förmlichen Bannspruch belegt. Das Urteil ließ ihm nur die Wahl, den seit Monaten verwaisten Posten in der neuspanischen Missionsstation anzutreten oder sich für seine »schändlichen Vergehen« vor dem Heiligen Tribunal zu verantworten. Fray Diego war weder ein Held noch ein Märtyrer, also hatte er sich entschieden, die Nachfolge von Pater Ramón, Gott sei ihm gnädig, anzutreten. Der alte Priester hatte in der entlegenen Missionsstation jahrzehntelang aufopfernd gewirkt. Aber in der Einsamkeit war er schließlich schwermütig geworden und hatte sich, Gnade seiner Seele, am Glockenstrang seiner Buschkapelle erhängt.
Fray Diego schob den Brief in seine Kutte und erhob sich. Sein Diener Hernán lag auf einer Taurolle vor der Reling. Der Mönch trat neben ihn und lehnte sich an das Geländer. Auch hier regte sich nicht das schwächste Lüftchen, doch zumindest war die Sonne hinter einer Wolke verschwunden, die für einige Minuten Linderung versprach. Schon seit sie vor acht Tagen den Golf von Hispaniola passiert hatten, kreuzten sie durch karibische Gewässer. Aber an die feuchte Hitze der Tropen würde er sich nie gewöhnen, dachte der Mönch.
Hernán, der eigentlich Pío Hernández hieß, blinzelte träge in den Himmel. Er war ein junger Mestize, kaum zwanzig Jahre alt, und stammte aus der Gegend von San Benito. Fray Diego hatte ihn im Hafen von Malaga angeheuert und gleich mit an Bord der Santa Magdalena genommen. Als Missionar im Regenwald brauchte er zumindest einen Gehilfen, der sich mit Sprache und Gebräuchen der Eingeborenen auskannte.
Von San Benito, dem winzigen Hafen, war vom Schiff aus nur die kleine Bucht zu sehen, das Wasser jadegrün und unbewegt. Dahinter erhob sich die Gouvernementsverwaltung, ein weiß getünchter Flachbau, von Palmen gesäumt. Ein leerer Platz umgab das Gebäude, gerodet zum Schutz vor Überfällen, wie Fray Diego vermutete. Rings umher, soweit das Auge reichte, dehnte sich, flirrend grün und undurchdringlich, der Regenwald.
Die grüne Hölle. Wäre es nach ihm gegangen, er hätte niemals einen Fuß auf neuspanischen Boden gesetzt. Aber in der alten Welt war er untragbar geworden, geächtet, weil er einer Verfolgten in seiner Klause Zuflucht gewährt hatte. Als Bußmönch vom Orden des heiligen Franziskus und Priester der katholischen Kirche hatte er es für seine selbstverständliche Pflicht gehalten, Isabella da Cazorra vor ihren Häschern zu beschützen. Doch sein Mitleid war ihm übel vergolten worden. Die Schergen, die Anfang Februar in seiner Klause erschienen waren, um Isabella da Cazorra abzuführen, standen in Diensten des Inquisitors von Malaga.
Vor einer halben Ewigkeit schon hatten sie die Flagge aufgezogen, die den Lotsen herbeirufen sollte. So jedenfalls der graubärtige Kapitän Veracruz, der sich auf das Achterdeck begeben hatte, um Pater Diego, dem einzigen zahlenden Passagier der Santa Magdalena, die Verzögerung zu erklären. Seltsamerweise dümpelte der Katamaran, mit dem der Lotse sonst auszulaufen pflegte, noch immer an der Hafenmauer von San Benito. Genaugenommen schien sich dort an Land überhaupt nichts zu regen. Außer den Möwen, die mit eintönigem Kreischen über dem Kai kreisten, und dem Klumpen schwarzer Geier, die sich neben dem Gouvernementsgebäude an einem Kadaver zu schaffen machten. Kapitän Veracruz stellte eigens sein Fernrohr scharf, damit Fray Diego das Boot und die Vögel in den Blick fassen konnte.
Die Bucht von San Benito sei für ihre Sandbänke berüchtigt, fuhr Veracruz fort. Ohne kundigen Führer dürfe man nicht wagen, in den Hafen einzulaufen. Andererseits könne er auch nicht länger auf den Lotsen warten, da die Santa Magdalena dringend in Hispaniola erwartet werde. »Mit Eurem Einverständnis, Frater, lassen wir das große Boot zu Wasser, und der Maat bringt Euch mitsamt Gepäck und Eurem Diener an Land.« Er kraulte sich den Bart und machte sich auf Einwände seines geistlichen Passagiers gefasst.
Der Pater zuckte mit den Schultern. Im Grunde war es ihm egal. San Benito oder Hispaniola, es war alles dieselbe verfluchte Hölle. Viel zu heiß, viel zu feucht. Von Dschungel überwuchert, von braunen Wilden bevölkert, die in primitiven Hütten hausten und barbarische Dialekte sprachen. Auch wenn gerade sein eigener Orden sich seit Jahrhunderten um die Missionierung der hiesigen Heiden bemühte, Neuspanien war allenfalls für Glücksritter und Goldgräber ein gelobtes Land. Ansonsten zogen aus Kastilien bloß die Geächteten und Verbannten in die neue Welt. Zu denen auch er gehörte, seit er gewagt hatte, Isabella da Cazorra zu beschützen, die nach Ansicht des Inquisitors eine Satansbuhlin war.
Er konnte von Glück sagen, dass ihm das Schicksal der Señorita erspart geblieben war. Dass sie ihn nicht an den Pranger gestellt, mit Hohn und Kot übergossen hatten. Oder gar bei lebendigem Leib verbrannt, wie es in Spanien noch immer jenen Unseligen geschah, die der Häresie bezichtigt wurden.
»Dann sind wir uns also einig?«, fragte Veracruz.
Fray Diego nickte. Flüchtig wunderte er sich über die Erleichterung im Gesicht des Kapitäns. Veracruz schien froh, sie endlich vom Hals zu haben, vor allem den Mestizen Hernández, von dem die Matrosen während der gesamten Seereise gemunkelt hatten, dass er von Dämonen besessen sei. Ein Argwohn, den im Übrigen auch der Pater nicht abwegig fand. Dennoch hatte er nur geringe Anstrengungen unternommen, diesen Verdacht vor dem Kapitän und der Mannschaft zu entkräften. »Pío Hernández ist ein getaufter Christ wie Ihr und ich.« Das war die Wahrheit und hatte doch niemanden überzeugt. Am wenigsten ihn selbst.
2
Von vier Matrosen gerudert, gelangte das Beiboot der Santa Magdalena rasch zum Kai. Der Maat ließ beidrehen und bot Fray Diego den Arm, um ihm an Land zu helfen. Schon hievten die Matrosen das Gepäck des Paters auf die Hafenmauer: zwei Koffer, die Kanten mit Eisen beschlagen, eine Seekiste, schmal und länglich wie ein Kindersarg. Als Letzter tänzelte Hernán von Bord, seinen Seesack geschultert, in gebauschtem Hemd und engen schwarzen Hosen, mit rotem Halstuch und Hütchen nach kastilischer Art. Der junge Mestize war der eitelste Mensch, der Fray Diego je begegnet war. Dabei war er von schmächtiger Statur, und sein rundes Gesicht mit den pechschwarzen Augen hatte meist einen verschlagenen Ausdruck, der wenig anziehend war.
Der Maat hob die Hand zum Abschiedsgruß. Schon legte das Boot wieder ab und hielt auf die Karavelle zu, wo am Hauptmast bereits wieder Segel aufgezogen wurden. Eine Eile, die Fray Diego unter anderen Umständen vielleicht verdächtig gefunden hätte. Nach drei Wochen auf rollender See aber war er vor allem erleichtert, Land unter den Füßen zu spüren. Auch wenn es das Land der Verbannten war. Die karibische Hölle, ein kastilischer Fiebertraum seit Generationen.
Er wies den Mestizen an, ihr Gepäck zu bewachen. Flüchtig kam ihm der Gedanke, dass Hernán seine Abwesenheit nutzen konnte, um mit seinen Habseligkeiten auf und davon zu gehen. Und wenn schon. Er wandte sich um und trottete auf das Gouvernementsgebäude zu. Ein halbes Hundert Schritte in gleißender Sonne, die längst wieder hinter den Wolken hervorgekommen war. Der Boden aus gestampftem Lehm, gespickt mit Pfützen und Vogelkot. Noch immer war auf dem ganzen weiten Platz keine Menschenseele sehen. Insbesondere nicht Abt Pedro, der doch versprochen hatte, ihn hier am Hafen abzuholen.
Allerdings hatte sich die Santa Magdalena wegen widriger Winde um einen Tag verspätet. Dringende Pflichten mochten Pedro gehindert haben, in San Benito auszuharren. Schließlich hatte der Abt eines Franziskanerklosters Besseres zu tun, als tagelang auf die Ankunft eines Geächteten zu warten. Und wäre der auch ein alter Freund aus Novizentagen, gemeinsam durchlitten im Kloster von Acarena. Damals hatte ihre Freundschaft oft für stille Heiterkeit gesorgt, denn äußerlich war Diego in allem Pedros Gegenteil: hager und hochgewachsen, raubvogelhafte Züge unter dichtem schwarzem Schopf. Mittlerweile waren sie über dreißig – längst keine jungen Männer mehr. Falls Pedro nicht warten konnte, dachte Fray Diego, wird er zumindest eine Nachricht für mich hinterlassen haben.
Aus der Nähe wirkte der Verwaltungsbau abweisend wie eine Festung. Auf dem Dach die königliche Flagge, schlaff herabhängend, noch immer ging nicht der leiseste Wind. Die Fenster vergittert, schmal, das hohe Tor mit Eisen beschlagen. Und verschlossen und verriegelt, als er endlich davor stand. Er ließ den eisernen Klopfer niedersausen, ein Drachenhaupt mit aufgerissenem Maul. Hinter dem Tor verbreitete sich ein hohles Dröhnen.
Fray Diego wartete. Keine Schritte, keine Rufe, nichts. Er ließ das Drachenmaul noch einmal niedersausen und sah jetzt erst, wen das eiserne Bildnis darunter darstellte: Drachentöter Georg mit gezücktem Schwert. Unruhe stieg in ihm auf. Das Dröhnen hinter dem Tor erstarb. Er legte sein Ohr ans Torholz und lauschte. Nichts. Nur das leise Brausen der Brandung in seinem Rücken, und hoch über seinem Kopf das Kreischen der Möwen, misstönend und seit Wochen vertraut.
Die Geier fielen ihm ein, der dunkle Klumpen, flatternd wie Lumpen über Aas. Er spürte einen Schauder, im Nacken und das Rückgrat hinab. Wie wenn ein Finger dir flaumweich über den Rücken fährt. Nie erlebt, oftmals heiß erträumt. Am sehnlichsten in jenen Nächten, die Isabella da Cazorra in seiner Klause verbrachte. Zum Greifen nah, doch er lag auf seiner Lagerstatt, wie in Fesseln geschlagen.
Er wandte sich nach rechts und folgte der Vorderfront des lang gestreckten Baus. Schweiß lief ihm über die Stirn, in den struppigen Bart. Schon während er näherkam, stieg ihm Aasgeruch in die Nase. Er bog um die Ecke, und da hockten sie, sieben Geier, acht, und zerrten mit Schnäbeln und Krallen an einem Geschlinge aus Eingeweiden und Blut.
Sie sahen nicht einmal auf, als er neben den Kadaver trat. Gottlob nur ein totes Pferd, erkannte Fray Diego, allerdings gesattelt und gezäumt, als ob es im Kampf getötet worden wäre. Er trat noch einen Schritt näher, da ließen einige Geier von der Beute ab und wandten sich, die Flügel ausgebreitet, krächzend gegen ihn. »Schon gut«, murmelte er, »diese Mahlzeit neide ich euch nicht.«
Unmöglich noch festzustellen, wie der Falbe umgekommen war. Aus Brust und Rücken sahen schon die Knochen hervor, der Kopf war nicht einmal angenagt. Still blickte er in die riesigen Augen, die hervorgequollen waren und gleich darauf im Tod erstarrt. Jedenfalls musste das Pferd heute früh noch am Leben gewesen sein. Läge der Kadaver schon länger als einige Stunden hier, überlegte Fray Diego, so hätten die feuchte Hitze und die Totenvögel ihm noch viel ärger zugesetzt. Unter diesen Umständen konnte auch der Reiter, lebend oder tot, verwundet oder unversehrt, nicht weit gekommen sein.
Er kehrte zur Ecke des Verwaltungsgebäudes zurück und wollte Hernán durch ein Zeichen bedeuten, zu ihm zu stoßen. Aber der Mestize hockte auf der Hafenmauer und sah hinaus auf die weite See. Ob er seinen Entschluss schon bereute, in die Heimat zurückzukehren? Jedenfalls musste der Pater weiter ohne ihn auskommen, denn nach ihm rufen wollte er nicht. Seit er das tote Pferd gesehen hatte, eigentlich schon, seit er gegen das Tor geklopft hatte, spürte er, dass sie in Gefahr waren.
Mörder, Krieger, Soldaten. Von wem genau die Gefahr ausging, wusste er natürlich nicht. Aber seit seiner frühen Kindheit besaß er einen Sinn für verborgene Bedrohungen. Nur dank dieses Sensoriums hatte er Isabella da Cazorra rechtzeitig verstecken können, einen Lidschlag, bevor die Schergen des Inquisitors an seine Tür geklopft hatten. Andererseits hatte der Sinn ihn nicht davor gewarnt, dass er seine priesterliche Existenz untergraben würde, wenn er ihr Obdach gewährte.
Wieder wandte er sich um und folgte nun der Schmalseite des Gebäudes. Für einen Moment glaubte er den Gestank und die Hitze nicht länger zu ertragen. Dabei hatte er den Kadaver und die geflügelten Totengräber längst hinter sich gelassen. Aber der Leichengeruch wurde immer stärker, und im gleichen Maß stieg seine Nervosität.
Auf Zehenspitzen schlich er zum Ende der Schmalseite und bog um die hintere Ecke des Bauwerks. Der Anblick, der sich ihm bot, war noch ärger, als er befürchtet hatte. Eine mannshohe Mauer umgab den Platz hinter dem Gouvernementsgebäude. Im Hintergrund befanden sich Ställe und Schuppen, hinter einem halb geöffneten Tor waren Karren und Droschken zu sehen. Wenige Schritte vor ihm aber, aufgereiht vor der Rückfront des Hauptgebäudes, lagen sieben, elf, dreizehn Männer, alle weißhäutig, nackt, in mittleren Jahren, alle auf die gleiche Weise verstümmelt und offenkundig tot.
Zweierlei fiel ihm auf, als er mit angehaltenem Atem nähertrat. Pedro war nicht unter den Toten, Gott sei Dank. Und die Körper waren mit Sicherheit nicht von Geiern verstümmelt worden. Dieser Hinterhof schien vielmehr ein karibisches Wunder zu sein: voller Leichen und doch kein Geier weit und breit.
3
Er schob die Tür auf und prallte zurück. Der Boden verklebt mit gestocktem Blut. Wie Nebel quoll ihm Aasgestank entgegen. Fray Diego drückte sich einen Ärmel seiner Kutte vor Mund und Nase. Dann zwang er sich, den Stall zu betreten.
Hinter der Schwelle blieb er stehen und lauschte. Kein Winseln, kein Atmen, Keuchen, nichts. Dämmerlicht, das aus Dachluken sickerte. Er stand in einem schmalen Gang. Hölzerne Verschläge zu beiden Seiten, davor Halbtüren, die ihm bis zum Gürtel reichten. Er trat näher und schaute in den ersten Verschlag. Selbst hinter seinem Ärmel wagte er kaum mehr zu atmen. Hustend eilte er den Gang entlang, links und rechts über die Bretter spähend. Dabei ahnte er längst, dass sich ihm überall der gleiche Anblick bieten würde. Zwölf Pferde zählte der Pater, alle auf die gleiche Weise verstümmelt und seit vielen Stunden tot.
Länger waren der Gestank, das gestockte Grauen nicht zu ertragen. Er wandte sich um und hastete zurück zur Tür. Wer auch immer dieses Gemetzel angerichtet hatte, war längst in die Tiefen des Waldes entflohen. Er trat hinaus auf den Hof. Für einen Moment musste er die Augen schließen. Behutsam atmete er ein und aus.
Gemetzel, dachte er, war nicht das richtige Wort. Eher etwas wie zeremonielle Schlachtung, wenn auch mit spürbarem Unterton: Rachegier, Hass. Als hätten die Täter gewisse Tötungsriten angewendet, vielleicht entlehnt von einem der hiesigen Götzenkulte, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Was natürlich bedeuten würde, dass es sich um heidnische Eingeborene handelte, die laut Abt Pedro noch immer zuhauf im Dschungel lebten. Wo sie auf ihn, Fray Diego, warteten, damit er sie zum gekreuzigten Heiland bekehrte. Oder um ihn nach ihrer Art zu Tode zu bringen – indem sie ihm das Herz aus der Brust schnitten, wie es den dreizehn Männern dort drüben geschehen war.
Geschlachtet. Oder hingerichtet. Oder geopfert. In Gedanken probierte er verschiedene Wörter aus. Hatten sie noch gelebt, als ihnen die Klinge in die Brust fuhr? Fast noch mehr als die Ermordung der Männer erschreckte ihn, dass die Pferde auf die gleiche Weise getötet worden waren. Mit scharfen Schnitten in die Brust. Waagrecht und so lang, dass man sich unwillkürlich vorstellte, wie groß so ein Pferdeherz war. Sehr viel schwerer war es, sich die Denkweise von Menschen vorzustellen, die aus Hass oder Rachedurst Pferde töteten. Oder deren Kultus ihnen solches Blutvergießen befahl.
Als seine Augen sich wieder an die Sonne gewöhnt hatten, stand Hernán vor ihm. Der Mestize fletschte die Zähne und deutete mit dem Kopf nach links. Selbst das rote Hütchen saß links auf seinem Borstenkopf, wie ein stilles Signal. Fray Diego sah in die angegebene Richtung und zurück. Jetzt erst erkannte er, dass Hernán mit den Lippen stumme Worte formte: Da – sind – sie. Erschrocken sah er nochmals hin, zu dem Schuppen, der sich seitlich an die Ställe anschloss. Hinter dem halb geöffneten Tor hatte er vorhin, von der anderen Hofseite, mehrere Droschken gesehen. Dort drinnen hocken sie? Er fragte es mit den Augen. Hernán nickte. Im nächsten Moment wandte er sich um und eilte an der Wand entlang, auf das Schuppentor zu.
Nach mehr als dreißig Lebensjahren kannte Fray Diego seine Schwächen. Oft hatte er erfahren müssen, dass er auf körperliche Bedrohung feige reagierte. Verzagt und konfus. Heute aber empfand er keine Angst, allenfalls leise Beklemmung bei dem Gedanken, dass die Mörder sich dort im Schuppen verbergen mochten. Als ob durch seine Begegnung mit Isabella da Cazorra etwas in ihm verwandelt worden wäre. Oder als hätte er als Geächteter kein Recht mehr, um Leib und Leben zu bangen.
Spaltbreit stand das Schuppentor auf. Hernán schlüpfte hindurch, Fray Diego folgte ihm. Sein Herz begann nun doch schneller zu schlagen. Schweiß rann ihm über die Schläfen und brannte in seinen Augen. Er musste blinzeln. Für einen Moment sah er gar nichts. Dann schälten sich die Konturen von Droschken, Kutschen, offenen Karren aus der Dunkelheit. Hinter dem Mestizen tapste er tiefer in den Schuppen hinein.
Was suchten sie hier? Vielleicht nur ihren Tod. Was für ein Leichtsinn, im Finstern herumzustolpern. Wenn sich wirklich die Mörder in diesem Schuppen verbergen, blasen sie auch uns das Licht aus, dachte Fray Diego. Der im gleichen Moment gegen einen Körper prallte, Keuchen hörte, Atem spürte, der heiß über seinen Arm fuhr. Unversehens fand er sich in ein Handgemenge verwickelt. Eine Faust traf ihn in den Bauch. Er keuchte, doch er hielt seinen Gegner umklammert. Beide stürzten sie zu Boden. Der andere war von kleinerer Statur als er, aber behände und zäh. In Staub und Streu, zwischen Karren und Droschken rang Diego mit seinem Widersacher, erbittert wie niemals mehr seit seiner Knabenzeit. Nein, das stimmt nicht, dachte er plötzlich, vor wenigen Wochen erst hatte er genauso handgreiflich gekämpft. Mit Hernán. Allerdings im Traum. Dem beklemmendsten Traum, der ihn jemals heimgesucht hatte. Als er erwachte, hatte er den Mestizen zum Teufel jagen wollen. Um dann zu erkennen, dass er gerade durch den Traum an Hernán gekettet worden war.
Ein heftiger Schlag traf ihn an der Schläfe. Nur einen Moment unachtsam, dachte er, dann wurde es schwarz um ihn.
4
Er lag im Schatten einer Palme. Blinzelte in den Himmel und zählte die Kokosnüsse, die rot und prall unter dem Blätterschurz hervorsahen. In seinem Kopf klopfte ein Schmerz. Nur langsam wurde ihm bewusst, dass in seiner Nähe jemand stöhnte. Er richtete sich auf und stöhnte seinerseits, als ihm ein Stich durch die Schläfe fuhr. Drei Schritte neben ihm, gleichfalls unter einer Palme, lag Hernán.
Sein rechtes Auge war geschwollen, auf seinem Kinn klebte Blut. Das rote Hütchen lag neben ihm am Boden, zerdrückt. Seine Füße waren mit einem Seil gefesselt, die Hände hinter dem Rücken verschnürt. Überdies hatten sie ihn geknebelt, mit einem Stofffetzen, den er vergeblich auszuspucken versuchte. Unablässig rollte er mit den Augen, bis Fray Diego verstand: Hernán bedeutete ihm, ihn loszubinden.
Der Pater sah an sich herab. Erstaunlicherweise war er nicht gefesselt worden. Dabei schienen ihre Gegner, wer immer sie sein mochten, über einen makabren Ordnungssinn zu verfügen. Sie hatten ihn und Hernán vor den Kutschenschuppen verfrachtet und so sorgfältig unter die beiden Palmen gelegt, wie auf der anderen Hofseite die Leichname aufgereiht lagen. Aber wieso hatten sie es dann versäumt, auch ihn zu fesseln?
Fray Diego erhob sich und ging zu Hernán hinüber. Der Schmerz in seinem Kopf pochte stärker. Er kniete sich neben den Mestizen und wollte ihm eben die Fesseln aufnesteln, als über ihren Köpfen eine Stimme erklang: »Wa’tal!«
Was sollte das bedeuten? Und in welcher Sprache überhaupt? Fray Diego erhob sich wieder. Die Stimme war aus einem Fenster gedrungen, im Erdgeschoss des Gouvernementsgebäudes. Das Fenster war geöffnet, allerdings vergittert und durch die Palme halb verdeckt. Hinter den Gitterstäben stand ein Indio, eine stämmige Gestalt in weißer Tunika. Mit unbewegter Miene wiederholte er sein Kommando: »Wa’tal!«
Fray Diego verstand den Wortlaut sowenig wie zuvor. Aber was der braune Krieger ihm bedeuten wollte, war dennoch klar. In der rechten Hand hielt er einen Speer, in Schulterhöhe erhoben. Die Spitze zielte auf Fray Diegos Herz.
»Ehrwürdiger Pater, was für eine Freude, Euch wieder bei Bewusstsein zu sehen.« Eine helle Stimme, die reinstes Spanisch sprach. Was sollte das nun wieder bedeuten? Fray Diego wandte sich um. Aus dem Schuppen trat ein junger Mönch, die schlanke Gestalt in brauner Kutte wie er selbst. Er mochte in Hernáns Alter sein, zwanzig Jahre oder wenig darüber. Aber so braun der Mestize war, so bleich war das Antlitz dieses jungen Mitbruders. Dessen Augen allerdings leuchteten – vor Frömmigkeit? Oder etwa vor Freude, dachte Diego, mich zu sehen?
Der kleine Mönch ergriff seine Hände und sank vor ihm auf die Knie. »Verzeiht, Pater Diego, es war ein Versehen. Ich dachte ... wir glaubten ... dass Ihr zu den Mördern ... um Himmels willen, verzeiht!«
»Ruhig, nur ruhig.« Behutsam richtete Fray Diego die bebende Gestalt auf. »Ist ja schon gut«, sagte er. »Woher kennst du mich? Wie ist dein Name, Frater?«
»Cristobál Ná, ehrwürdiger Vater.« Seine junge Stimme klang auf einmal eifrig. »Der ehrwürdige Abt hat mir Euch beschrieben – Abt Pedro, der mich am letzten Geburtsfest unseres Herrn zum Taufpriester geweiht hat.« Noch immer leuchteten seine Augen, selbst hinter Tränen. Vertrauensvoll sah er zu Fray Diego auf.
»So ist das also.« Der Pater murmelte es, tief in Gedanken. Allmählich löste sich seine Verwirrung. Auf seinem Gesicht erschien ein abwesendes Lächeln. »Du hast mich also zu Boden geschlagen, Fray Cristo?« Der kleine Taufpriester errötete. Aufs Neue wollte er zu stammeln beginnen, aber der Pater schnitt ihm das Wort ab. »Ich trage es dir nicht nach. Und wenn mir nicht etwas dazwischengekommen wäre, glaube mir, ich hätte nicht gezögert, dich ebenso niederzuwerfen. Natürlich nur deshalb, weil auch ich nicht wusste, mit wem ich da handgreiflich geworden war.«
»Dazwischengekommen, Pater?«
»Oh, nur ein Traum«, sagte Fray Diego, weiterhin mit abwesendem Lächeln. Sein Blick fiel auf Hernán. »Oder war es doch mehr als ein Traumgespinst? Aber darum geht es im Moment nicht«, fuhr er fort, als er Cristobáls neuerliche Verwirrung spürte. »Das da sind doch deine Leute, Fray Cristo?« Er deutete zum Fenster. Dort standen drei Indios, mit reglosen Mienen, auf ihre Speere gestützt.
»Unsere Leute«, erklärte der Taufpriester. »Abt Pedro hat sie mir mitgegeben, damit sie Euch und mir zur Seite stehen. Als Kutscher, Ruderer, Träger auf dem Weg zur Missionsstation.«
»Mir und dir? Soll das heißen, dass Don Pedro nicht nach San Benito gekommen ist? Dass er stattdessen dich geschickt hat, um mich in den Dschungel zu begleiten?«
»Bitte versteht doch«, flüsterte der kleine Mönch, schon wieder den Tränen nahe. »Der ehrwürdige Abt ... dringende Pflichten halten ihn im Kloster fest ... Es geht um ...«
Seine Rede drohte gänzlich zu versiegen. Desto lauter stöhnte und knurrte hinter seinem Knebel Hernán.
»Lass meinen Diener losbinden«, befahl Fray Diego. »Und dann heraus mit der Sprache: Was wird hier gespielt?«
Der barsche Ton schien Cristobál den letzten Mut zu rauben. »Verzeiht, dass ich Euren Diener fesseln ließ. Es war nur, weil ... Er trat und schlug um sich, er biss und spuckte, als ob ein Dämon...«
»Unsinn! Er glaubte, genau wie ich, dass in dem Schuppen die Mörder dieser Männer lauerten.«
»Wie umgekehrt wir annahmen, dass Ihr ...«
»Ich weiß«, fiel ihm der Pater wieder ins Wort. »Wir alle haben uns geirrt und voreilige Schlüsse gezogen.«
Aus einer Tür in der Hinterfront traten die drei Indios hervor. Maya nannten sie sich, fiel Fray Diego ein, was in ihrer Sprache einfach Mensch hieß. Nun, Menschen waren sicherlich auch sie. Einer von ihnen, der stämmige Krieger, der vorhin seinen Speer auf ihn gerichtet hatte, kniete sich neben Hernán und begann die Fesseln zu lösen. Den Knebel riss sich der Mestize selbst aus dem Mund. Dann sprang er auf, wie von einem Katapult geschnellt.
Seine Augen funkelten, die ganze Gestalt schien zum Bersten angespannt. Er bohrte seinen Blick in Fray Cristos Augen. Nur allzu deutlich verriet sein Gesicht, dass er vor Zorn und Rachedurst brodelte. Fray Diego bedeutete ihm durch ein Zeichen, sich zu mäßigen. Da wandte sich der Mestize mit einer wütenden Gebärde ab und lief davon. Über den Hof, an den aufgereihten Toten vorbei, um die Ecke des Hauses, wo er ihren Blicken entschwand.
»Er wird sich wieder beruhigen«, sagte Fray Diego. »Aber nun zur Sache: Was lässt Don Pedro mir ausrichten? Welche Pflichten hindern ihn, mich persönlich zu begrüßen?«
»Mein Rang ist gering, Pater.« Cristobál senkte den Kopf. »Ich verstehe nur wenig von diesen Dingen. Aber soweit ich weiß, geht es um eine Verschwörung. Überall im Land, heißt es, kehren ganze Mayadörfer zu den alten Götzenkulten zurück. Mehrmals schon ist es zu Übergriffen gekommen – gegen die weißen Eindringlinge, wie es auf einmal wieder heißt. Auch zu Mordanschlägen und Massakern wie hier.« Seine Lippen bebten. »Stellt Euch das nur vor, Pater – als ob sie die Botschaft Christi nie vernommen hätten!«
»Oder als ob er uns seine Macht in Erinnerung rufen will.« Der Fürst dieser Welt. Er hatte tief in Gedanken gesprochen, fast tonlos. Aber das bestürzte Gesicht des Taufpriesters verriet, dass Cristobál sehr wohl verstanden hatte.
Für einen Moment herrschte Schweigen.
»Die Verschwörung, von der du sprachst«, sagte der Pater dann, »erklärt vielleicht die blutigen Spuren, auf die wir hier gestoßen sind. Aber ich erkenne den Zusammenhang nicht: Inwiefern hindern diese Vorgänge Abt Pedro, sein Kloster zu verlassen?«
»Davon weiß ich nichts.« Der kleine Mönch sprach flüsternd. »Dazu kann ich nichts sagen.«
Fray Diego beugte sich hinab und lauschte. Aber das dünne Rinnsal der Rede war schon wieder versiegt. Er blickte in die Augen des jungen Mönches, die noch immer von Tränen verschleiert waren. Auf einmal fielen ihm die Toten wieder ein. Er sah über den Hof, wo sie aufgereiht lagen. Seltsam, immer noch zeigten die Geier kein Interesse an den Leichnamen. Und über dem Dutzend toter Pferde in den Ställen hatte nicht einmal eine Fliege gesurrt. Unheimlich, dachte der Pater. Zu den Tötungsriten musste irgendein Kunstgriff gehören, der aasfressende Tiere vor den kalten Körpern zurückschrecken ließ. Eben wollte er den Mund öffnen, um Fray Cristo zu befragen, da sprach der kleine Mönch weiter:
»Letzte Woche traf eine hohe Gesandtschaft im Kloster ein. Aus dem Vatikan, wie man hört. Agenten des Heiligen Vaters. Beauftragt, die Verschwörung zu enthaupten ... vielleicht. Aber das ist Politik. Davon verstehe ich wirklich nichts. Nur dass der ehrwürdige Abt ... also, wie Don Pedro sagte... Unter diesen Umständen sei es besser, Frater, wenn Ihr...«
Mit ängstlicher Miene sah der Taufpriester zu Fray Diego auf. Er brachte kein Wort mehr heraus. Aber der Pater las in seinen Augen, was Cristobál die Kehle verschnürte. Abt Pedro befürchtete offenbar, dass sein alter Freund Diego weiteres Ungemach heraufbeschwören würde, wenn er im Kloster mit den vatikanischen Agenten zusammenträfe. Eine verständliche Sorge, dachte der Pater. Unweigerlich würde auf Pedros Ansehen ein Schatten fallen, wenn er sich vor den Gesandten als Vertrauter eines verbannten Priesters zu erkennen gab. Also hatte der Abt beschlossen, ihn auf direktem Weg zur Missionsstation bringen zu lassen. Drei Tagesmärsche tief im Dschungel – »einer der harschesten Außenposten der Christenheit«, wie Pedro in seinem letzten Brief gescherzt hatte. Und so weit von aller Zivilisation entfernt, dass kein römischer Gesandter sich dorthin verirren würde.
»Ich will nicht weiter in dich dringen, Cristobál«, sagte er. »Don Pedro hat sicher seine Gründe, die er mir bei Gelegenheit darlegen wird.« Er nickte dem jungen Mönch zu und wandte sich ab. Seine Gedanken waren bei dem Tötungsritual, in dem Grausamkeit und Kunstfertigkeit rätselhaft zusammenflossen.
5
Halsbrecherisch holperte die Kutsche über den Fahrweg, der San Benito mit dem Rio Hondo verband. Fünf Stunden landeinwärts bis zur Uferlände, dann die ganze Nacht stromab im klösterlichen Kajütboot. So jedenfalls Fray Cristobál, der neben dem Pater in der Kutschkabine saß. Vor den Fenstern zogen die grünen Wände des Dschungels vorbei. Wuchernd, undurchdringlich, wohin Fray Diego seinen Blick auch schweifen ließ. Ein Wesen und Wimmeln, fieberbunt und sinnlos – Satanswelt, dachte er. Daran glaubte er wirklich. Vielleicht war es der einzige Glaube, der ihm geblieben war: dass diese Welt des Teufels war.
Vorn auf dem Kutschbock hockten der untersetzte Indio und ein zweiter Maya, von hagerer Gestalt. Jorge und Miguel, wie Fray Cristo die beiden vorgestellt hatte, seit Jahren in Diensten des Klosters, als Ruderer und Lastenträger, Kutscher und Jäger gleichermaßen bewährt.
Jäger. Das gefiel dem Pater gar nicht. Gegen frisches Wildbret, von Jorge oder Miguel erlegt, war sicher nichts einzuwenden. Aber vorhin hatte Jorges Speer nicht auf Hirsch oder Hase, sondern auf seine Brust gezielt. Er wischte sich den Schweiß aus dem Nacken und warf Fray Cristo von der Seite einen Blick zu. Dann beschloss er, ihn lieber nicht zu fragen, ob Miguel und Jorge zu trauen war. Ganz zu schweigen von dem dritten Maya, der neben Hernán auf der Gepäckrampe saß. Raoul, ein schmaler Bursche, der sich katzengleich bewegte, unfassbar rasch. Was umso unheimlicher wirkte, als diese Eingeborenen die meiste Zeit reglos dastanden oder am Boden kauerten. Mit unbewegten Mienen. Auf ihre Speere gestützt oder auf den Unterschenkeln hockend. Fray Diego fragte sich, ob die Zeit für sie vielleicht anders verging. Langsamer, oder in Sprüngen statt in stetem Strom.
Ihre Kutsche wurde von zwei Rappen gezogen. Vorhin in San Benito hatte Jorge den Zweispänner aus dem Schuppen geholt. Damit hatte Fray Diego überhaupt nicht gerechnet. Im Gegenteil, es kam ihm wie ein Trick vor, wie offenkundiger Betrug. Dreizehn tote Männer, dreizehn tote Pferde – aber Cristobál, seine Gehilfen und selbst ihre Kutschpferde waren unversehrt. Wie war das möglich? Hatten sie nicht seit gestern auf die Ankunft der Santa Magdalena gewartet? Mussten sie nicht längst in San Benito gewesen sein, als die Mörder (Krieger? Schlächter?) die Gouvernementsverwaltung überfielen? Wo hatten sie sich verborgen? Doch sicher nicht im Schuppen neben den Ställen, wo die Kutschpferde sie beim Todeskampf ihrer Artgenossen durch unbändiges Wiehern verraten hätten.
»Verzeiht, Pater«, lautete Fray Cristos Antwort, »auch wir hatten uns verspätet und kamen erst heute zur Sext in San Benito an. Da hatten die Mörder ihr blutiges Werk schon verrichtet und waren wieder auf und davon. Aus Angst, dass sie zurückkehren würden, verbargen wir uns im Schuppen, mitsamt der Kutsche und den Pferden.«
So konnte es gewesen sein, natürlich. Warum verspätet? Er verbiss sich auch diese Frage. Schließlich konnte er froh sein, dass Pedro trotz aller Widrigkeiten, mit denen er selber kämpfen musste, so umsichtig für seinen Empfang und seine Begleitung gesorgt hatte. Vielleicht hätte Fray Diego seinen Argwohn gleich wieder vergessen, wäre ihm nicht aufgefallen, dass die Maya verstohlene Blicke wechselten. Oder bildete er sich das nur ein? Sprachen die drei braunen Männer eigentlich auch Kastilisch? Ein paar Brocken, laut Fray Cristo, der seinerseits im Idiom der Maya nur wenige Wendungen beherrschte. Aber glücklicherweise hatte er ja Hernán, dachte der Mönch.
Die Mutter des Mestizen war eine Eingeborene aus einer Siedlung nahe San Benito. Seinen spanischen Vater hatte Hernán, als blinder Passagier tollkühn die Meere überquerend, von Malaga bis Marbella vergeblich gesucht. Daher sein Hass, seine innere Zerrissenheit, sagte sich der Pater. Dem allerdings an seinem Diener noch vieles rätselhaft war. Eigentlich alles, dachte er. Ein Geheimnis, erschreckend und anziehend zugleich.
Ehe sie San Benito verließen, hatte er den Toten die Augen geschlossen und ihre Seelen der himmlischen Gnade empfohlen. Der Rest war Sache der königlichen Polizei. Er hatte sich mit Fray Cristo beraten: Am Rio Hondo sollte sich Raoul von ihnen trennen und mit einem Einbaum die wenigen Meilen stromauf bis zum Kloster rudern. Er würde dem Abt einen Brief überbringen, der die nötigen Erklärungen zu den Bluttaten in San Benito enthielt. Währenddessen würden sie mit dem klostereigenen Kajütboot Santo Francisco XIII stromabwärts fahren, die ganze Nacht hindurch. Falls Abt Pedro ihnen eine Antwort schicken wollte, konnte er sich Raouls als Boten bedienen. Anderenfalls mochte der Indio getrost im Kloster bleiben. Raoul war der Unheimlichste von den dreien, dachte Fray Diego. Und falls einer von ihnen zu den Verschwörern gehörte, die zum Ruhm ihrer Götzen weiße Männer massakrierten, dann am ehesten der katzenhafte Raoul.
In zähem Trott zogen die Pferde ihre Droschke voran. Durch Schlammlöcher, über Wurzeln und Geröll. Immer wieder versperrten Kadaver den Fahrweg. Dann schnalzte Jorge mit der Peitsche, bis die Geier von ihrer Beute abließen. Die Schnäbel blutverschmiert, erhoben sie sich in die Luft und flogen auf die Wipfel der nächsten Bäume. Kaum war die Kutsche durch den Kadaver gefurcht, stoben die Totenvögel wieder hinab, um aufs Neue an dem blutigen Geschlinge zu zerren.
Der ganze Dschungel, schien es Fray Diego, war vom süßlichen Geruch der Verwesung erfüllt. Vielleicht war es noch nicht die wahrhaftige Hölle, aber einer der Vorsäle der Verdammten war es zweifellos. Eine tropische Vorhölle namens Petén, laut Pedros stets lehrreichen Briefen.
Müdigkeit überkam ihn. Immer wieder wiegte die Kutsche ihn bis an den Rand des Schlafs. Jedes Mal schreckte er wieder auf und zwang sich, die Augen offenzuhalten. Dem Urteil des kirchlichen Tribunals zu Malaga hatte er sich beugen müssen. Das hieß aber noch lange nicht, dass er sich in dieser faulig heißen Vorhölle von götzengläubigen Verschwörern abschlachten ließe. Fray Diego hatte nicht mehr viel zu verlieren. Und er war entschlossen, dieses Wenige zu verteidigen. Leib und Leben, fürs Erste jedenfalls. Und seine unsterbliche Seele, der letzte Trumpf, der ihm auszuspielen blieb. Wenn man vorhatte, den Teufel zum Kampf zu stellen, dachte der Pater, war der Petén eigentlich sogar ein angemessener Ort.
Andreas Gößling, geboren 1958 in Gelnhausen. Der promovierte Literatur- und Kommunikationswissenschafter beschäftigt sich seit vielen Jahren mit kultur- und mythengeschichtlichen Themen. Neben Romanen für erwachsene und junge Leser hat er zahlreiche Sachbücher publiziert und Forschungsreisen unter anderem im karibischen und südostasiatischen Raum unternommen. Andreas Gößling lebt mit seiner Frau, der Autorin und Sprachdozentin Anne Löhr-Gößling, bei Berlin.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783944488523458270
- Artikelnummer SW9783944488523458270
-
Autor
Andreas Gößling
- Verlag MayaMedia Verlag
- Veröffentlichung 04.08.2020
- ISBN 9783944488523