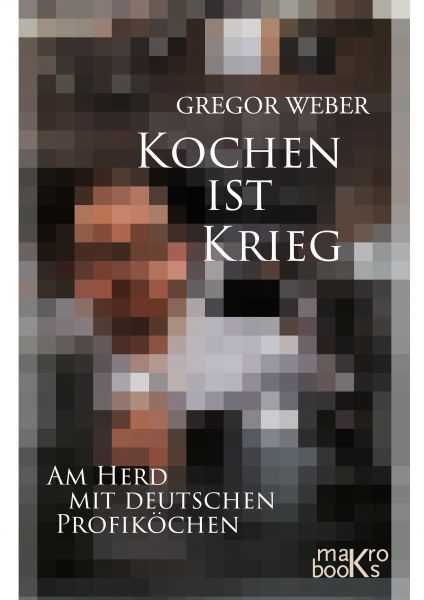Kochen ist Krieg
Am Herd mit deutschen Profiköchen
Als Beikoch, Lehrling, reisender Rührlöffelschwinger: Gregor Weber, Schauspieler im früheren Saarland-Tatort, Krimiautor, Bundeswehrsoldat und ausgebildeter Koch, macht sich auf die Reise durch zehn Profiküchen in Deutschland. Er kocht in Dorfgasthäusern und Sternerestaurants, Fußgängerzonenpizzerien, Betriebskantinen und beim Bundespräsidenten. Er dreht alle Töpfe um und berichtet, was Köchinnen und Köche dort leisten oder auch verbrechen: Die einen arbeiten zwei Tage lang an einer Kalbssauce, die anderen schütten Pulver in kochendes Wasser und rühren zweimal um. Es ist heiß in der Küche, sehr heiß...
Lehre. Vom Fernsehclown zum À-la-carte-Killer in zwei Jahren
Gastarbeit. Immer gucke die Teich, Giorgio!
Auf Gefechtsstation. Smut, Smutje, von »Smut«, für »Schmuddel«. Ein Schiffskoch
Schwarz Rot Gold. Deutsches für Ausländer oder Kochen für den Staat
Come together. Nah am Rand: Betreutes Kochen für Kunstbeflissene
Wellems Way. Wie man einen Tag am Meer auf den Teller bringt
Draußen. Von Wildschweinen und Wildkräutern
Tradition. Wenn einfach alles bleibt, wie’s ist
Ost! Ost! Ostberlin! Wir haben da mal etwas vorbereitet…Klasse in Masse
High End. Drei Sterne–Eine Reise wert (Guide Michelin)
Nachschlag
Reservierung. Wenn Sie selbst probieren wollen
Lehre. Vom Fernsehclown zum À-la-carte-Killer in zwei Jahren
Die Doppeltür schwingt, whap, whap, whap spuckt sie drei Kellner in die Küche.
» Zwei Gäste neu ! «
»Einmal vier und einmal drei Gäste neu!«
»Tisch dreiundzwanzig kann weiter!«
Nummer eins schneidet Brot auf, Nummer zwei schnappt vier Amusegueule vom Pass und fliegt wieder in den Gastraum, Nummer drei surft Richtung Klo, eher für eine hastige Zigarette als zum Pinkeln.
Küchenchef Marc klatscht zweimal und brüllt wie ein Ringsprecher beim Boxen: »Okay, Jungs. Als Nächstes gehen zwei Loup, einmal St. Pierre, ein Reh, eine Ente an die dreiundzwanzig. Haben das alle?«
» Jawoll, Chef ! « Kasernenton.
» Wann schicken wir ? «
»Saucier fertig in vier.«
Marc high fived mit dem Saucier: »Geiler Typ! Entremetier, was ist mit den Beilagen?« »... «
»Jemand zu Hause am Entremetier??« »Gleich ... äh ...«
»Was gleich, was äh? Was ist, bitteschön, unklar an zwei Loup, einem St. Pierre, einem Reh und einer Ente? Brauchen Monsieur noch Zeit zum Nachdenken? Saucier ist fertig in vier Minuten und ich frage dich: W-a-n-n, das meint: Wann kannst du schicken dein Scheiß? Also?«
Mist. Schon wieder aus der Kurve geflogen.
Es ist ein Samstagabend im Sommer vor fünf Jahren in der Küche des Berliner Spitzenrestaurants »VAU«. Hier arbeiten gerade elf Köche und Kochlehrlinge plus zwei Spüler, draußen im Service flitzen sechs Kellner. An den Tischen werden über sechzig Gäste erwartet. Sie sind wie immer in der Überzahl, und wer in Küche und Service nicht aufpasst, kämpft schnell auf verlorenem Posten.
Die kriegerische Terminologie passt durchaus zum beruflichen Selbstverständnis in der Gastronomie, denn die historische Abstammung von der Trossküche des mittelalterlichen Heeres schlägt sich in der auch heute noch quasimilitärischen Organisation von Profiküchen nieder. Das gesamte Küchenpersonal wird subsumiert unter dem Begriff »Brigade«. Die Brigade wiederum wird unterteilt in einzelne »Posten«, französisch »Partie«. Jeder Posten hat eine klar umrissene Aufgabe und einen altertümlichen französischen Namen: Der »Garde-Manger«, die »Essenswache«, ist für die kalte Küche und die Vorspeisen zuständig. Früher war er auch der Aufseher über die Lagerung und die sehr heikle Kühlung, daher der Name. Der »Entremetier«, also »Zwischengerichtemacher«, stellt die Beilagen zu den Hauptgängen her – Gemüse, Kartoffeln in allen Variationen, Teigwaren, Reis sowie alle Suppen. Der Posten »Saucier« ist für Fleisch, Fisch und Saucen zuständig. Derjenige Saucier, der den Fisch macht, nennt sich »Poissonnier«. Zu guter Letzt der »Patissier«, verantwortlich für Desserts, Kuchen, Gebäck und Brot.
In großen Brigaden gibt es noch feinere Unterteilungen, wie den »Potager«, der ausschließlich Suppen kocht, oder den »Charcutier«, den Küchenmetzger, der angelieferte Tiere zerlegt, Fleisch pariert und portioniert. In sehr traditionellen Hotelküchen heißen die Spüler gar »Casserolier«, ein an Spott grenzend feiner Begriff für einen der härtesten Jobs in der Gastronomie.
In meiner Lehrküche stehen an jedem Posten zwei Leute, dazu kommen insgesamt zwei bis drei Springer, meist Lehrlinge, die diverse Vorbereitungen übernehmen, das Aufräumen und Putzen erledigen sowie auf Zuruf alles machen oder herbeischaffen, was die Posten gerade benötigen. Die beiden Spüler teilen sich die Aufgaben strikt: Einer reinigt Geschirr und Besteck aus dem Restaurant, der andere die Töpfe und Pfannen der Köche, alles im Akkordtempo.
Die einzelnen Köche wiederum haben regelrechte Dienstgrade, die ihre Erfahrung und auch ihre Befehlsgewalt widerspiegeln. Ganz unten, wenn man mal vom »Apprenti«, dem Lehrling – also unter anderem mir –, absieht, steht der »Commis«, der »Gemeine«, der befehligt wird vom »Demichef de partie«, dem stellvertretenden Postenchef. Darüber steht der »Chef de partie«, dann kommt der »Sous-chef«, der Stellvertreter des »Chef de cuisine«, des Küchenchefs. Und wie beim Militär wird auch hier gerne mal gebrüllt. Überhaupt, der Ton: Kaum ein Arbeitsplatz dürfte in vergleichbarem Maße von Fäkalsprache und Aggression geprägt sein. Ein Teigschaber aus Kunststoff heißt hier, pardon, »Gummifotze«, ein Schneebesen mit Spirale »schwuler Schneebesen, weil die immer annander hängenbleim«, wie man mir grinsend erklärt. »Scheiße«, »Wichser«, »Penner« – alle drei Minuten hört man einen dieser Begriffe. Vegetarier und Allergiker sind »Foodkrüppel«, die gefälligst in andere »Scheißrestaurants« zu gehen und Ärger zu machen haben.
Doch allen verbalen Entgleisungen zum Trotz: In einer Spitzenküche spuckt Ihnen keiner in die Suppe, wird Essen, mit dem ein Gast nicht zufrieden ist, anstandslos neu gemacht. Der Fußboden mag zwar oft aussehen wie eine Müllkippe, was mit dem massiven Zeitdruck zu tun hat, aber Arbeitsflächen und Schneidbretter sind blitzblank und stets aufgeräumt. Denn: »Wie’s auf deinem Brett aussieht, so sieht’s in deinem Kopp aus!« Das war eine der ersten Regeln, die ich in der Ausbildung lernte. Peinlich gründliche Handhygiene und höchste Ansprüche an die Frische und Qualität der Zutaten sind hier selbstverständlich. Vor dem Abendservice putzen sich die Köche gründlich die Zähne, damit sie gut abschmecken können. Und obwohl kein Gast sie sieht, schlüpfen sie jeden Abend in eine frische, strahlend weiße Kochjacke. Das ist eine Frage der Ehre und des Berufsstolzes.
Ich koche heute als zweiter Mann am Entremetierposten. Das Restaurant ist ausgebucht, und mein Postenchef hat mich kurz allein gelassen. Er ist, wie die meisten hier, Mitte zwanzig. Küchenchef Florian ist Anfang dreißig, sein Kollege Marc fünfunddreißig. Ich bin sechsunddreißig und Praktikant. Extrawurstlehrling. Ich will hier lange genug arbeiten, um die IHK-Prüfung ablegen zu können. Fast ein Jahr habe ich schon geschafft.
Der Service läuft seit fünfundvierzig Minuten – und wird noch gut vier Stunden dauern. Jeder Gast wird im Schnitt drei bis vier Gänge plus je zwei Amusegueule essen, das heißt, wir schicken heute mindestens einhundertachtzig bis zweihundert große und einhundertzwanzig sehr kleine Teller mit frisch zubereitetem Gourmetessen in höchster Qualität raus. Schließlich befinden wir uns in einer der besten Küchen Berlins. Das »VAU« ist mit 17 von 20 möglichen Punkten im Gault Millau bewertet und trägt seit mehr als zehn Jahren einen Michelinstern. Um hier zu kochen, braucht man Power, Konzentrationsfähigkeit und eiserne Nerven. Man muss über solides handwerkliches Können und sehr flinke Finger verfügen. Verbrennungen und Schnittwunden dürfen einen nicht davon abhalten, bis zum Serviceende weiterzuarbeiten, und Anschisse hart an der Beleidigungsgrenze muss man widerspruchslos schlucken können.
Die Köche arbeiten gut sechzig Stunden in der Woche, und sie verdienen kein Vermögen dabei. Der Deal geht so: Du ackerst dich hier und in ein paar anderen Spitzenküchen zehn, fünfzehn Jahre lang krumm und bucklig, und dann kannst du alles, was du können musst, um vorne mitzuspielen. Das heißt aber nicht, dass du vorne mitspielen wirst.
Eine Vielzahl von sehr guten Restaurants überall in der Republik entlässt jedes Jahr mehr und mehr topp ausgebildete Jungköche in die Welt. Manche bleiben auf der Strecke. Halten dem Druck nicht stand, wechseln den Beruf, gehen zwei, drei Gastronomieklassen tiefer, weil da der Stress etwas abnimmt, oder driften ab in Drogen und Alkohol. Für die, die dranbleiben, gilt: Nicht jeder gute Koch ist auch ein guter Küchenchef, nicht jeder gute Küchenchef ist auch ein guter Wirt. Außerdem hat der Kochboom der letzten Jahre das Niveau der deutschen Spitzengastronomie um einiges angehoben. In dieser Kategorie können sich die Chefs die Aspiranten aussuchen, die meisten Lehrlinge haben Abitur.
Meine aktuellen Jobs für Tisch dreiundzwanzig sind: weiße und schwarze Cavatelli (sehr kleine Nudeln, natürlich hausgemacht) in weißem Tomatenfond mit Passe Pierre, einer kleinen Wasserpflanze, und Ofenpaprika zu den Loups de mer liefern. Für den St. Pierre mit Ochsenmark und Kalbsjus muss ich Safranrisotto zubereiten. Zum Reh gehören geschmorte Artischocken und ein Kartoffel-Wildkräuter-Püree, die Ente wird von gegrilltem Trevisano Tardivo, einer Art Radicchio, und cremiger Polenta begleitet. Alles gleichzeitig, und natürlich alles in der Qualität, die der Gast für fünfunddreißig Euro pro Teller erwarten kann. Außerdem: Wenn ich nicht das Gesicht verlieren will, alles in vier Minuten, denn dann sind Saucier und Poissonnier bereit zum Schicken.
Es ist neunzehn Uhr fünfundvierzig, der Service geht heute locker bis halb zwölf, es sind erst vierzehn von gut fünfundsechzig erwarteten Gästen da, und ich stecke jetzt schon in der Scheiße.
Eine Küchenbrigade im Service muss man sich wie ein schnell drehendes Uhrwerk vorstellen. Ein Zahnrad greift ins andere, und wenn es irgendwo hakt, kann alles zum Stillstand kommen. Bei mir knirscht es zumindest schon: Die Fertigstellung meiner Beilagen muss exakt mit zwei anderen Posten der Küche abgestimmt werden. Mit dem Saucier, der das Fleisch und die Saucen zubereitet, und dem Poissonnier, der den Fisch macht. Die beiden arbeiten mit dem richtig teuren Zeug – Loup de mer, St. Pierre oder Petersfisch, Rücken und Keule vom Brandenburger Reh sowie Brust und Keule von der Oldenburger Ente, Warenwerte um die zwanzig Euro.
Wenn sie mich mögen und wenn ich sie nicht enttäusche, helfen sie mir dabei sogar. Das heißt: Der Poissonnier fragt, bevor er den Fisch in die Pfanne haut, und der Saucier sagt mir Bescheid, wann das gebratene Fleisch fertig geruht haben wird. Wenn sie mich nicht mögen oder ich sie schon enttäuscht habe, dann muss ich selber sehen, wie weit sie sind. Und dann habe ich kaum eine Chance, die Beilagen rechtzeitig zu liefern. Nämlich dann, wenn die Jungs fertig sind.
Bin ich zu langsam, müssen sie den teuren Fisch und das exklusive Fleisch wegschmeißen und noch mal braten. Das mögen sie nicht, das mag der Küchenchef auch nicht, das mag der Wirt schon überhaupt nicht.
Also ranhalten. Habe ich meine Beilagen dann fertig, wartet ein Nadelöhr. Die Qualitätsprobe am Pass. Das ist der Ort, an dem das Essen angerichtet und von den Kellnern abgeholt wird. Hier steht der Abendchef und prüft. Was seinen Ansprüchen nicht genügt, wird verbessert oder, falls das nicht geht, weggeworfen und neu gemacht. Fallen meine Beilagen durch, kann der ganze Teller nicht raus, Fleisch und Fisch müssen ebenfalls neu gemacht werden. Wenn man sich all das Essen vor dem Nadelöhr vorstellt und den Druck, mit dem es dort hindurchgepresst werden muss, um in der erforderlichen Frequenz zu den Gästen zu kommen, wird einem klar, warum man in Profiküchen Essen »schickt«. Es ist ein hochdynamischer, stundenlang anhaltender Prozess, der nicht stoppen darf und auf Französisch »envoyer« heißt.
Während mir langsam der Schweiß in den Kragen rinnt, kommt mein Postenchef endlich zurück. Er schimpft irgendetwas von »nicht mal fünf Minuten alleine lassen«, allgemeines Gelächter um mich herum, mir egal, jetzt zählt nur eins: Denny is back. Der Chef-Entremetier bringt uns wieder zurück aufs Gleis. Dann kann der Küchen-ICE weiter durch die Nacht und durch meinen Kopf rasen. Neue Gäste, neue Bestellungen, mehr Bons an der Leiste, Extrawünsche noch und noch.
Den St. Pierre bitte ohne Ochsenmark, statt Artischocken lieber Vichy-Karotten (stehen nicht auf der Karte, müssen komplett neu gekocht werden), das Reh bitte durchgebraten, nein medium-rare, nein doch ganz durch, reg dich nicht auf, mach’s noch mal, ach, da ist ein Vegetarier, der will aber sechs Gänge essen.
Jetzt ist Denny voll gefordert. Als Chef-Entremetier muss er sich aus dem Stand ein vegetarisches Menü einfallen lassen. Er tritt gegen den Herd und motzt über die »Scheißveggies«, worauf ihm Küchenchef Florian, der heute als
Chefsaucier am Herd steht, sofort eins überbrät. Wenn er jetzt ausraste, könne er sich gerne umziehen und heimgehen. Oh nein. So wie Denny heute drauf ist, macht der das doch gleich. Dann lass ich aber die Luft komplett aus mir raus und geh durch den Abfluss heim.
Doch Denny-Man beruhigt sich, Profi halt, Gott sei Dank. Wenn beide Küchenchefs da sind, ist außerdem natürlich der Druck viel höher. Also konzipieren Denny und Marc innerhalb von drei Minuten ein vegetarisches Sechsgangmenü und legen los. Wir sind ein Sternerestaurant, der Gast ist König. Aber hallo.
Um halb zwölf haben wir es geschafft. Ging dann doch ganz gut. Denny ist zufrieden mit mir: »Wird doch langsam. Aus dir mach ich noch ’nen richtigen À-la-carte-Killer, und jetzt räum uff!« Beim Putzen denke ich an eine der großen Weisheiten aus dieser Küche und wie bescheuert ich die beim ersten Hören fand: »Kochen ist Krieg, Mann!«
Wie also gerät ein Familienvater und gelernter Schauspieler in seinen eher späten Dreißigern als Praktikant in eine Sterneküche voller High-Speed-Jungköche?
Mit Ende zwanzig konnte ich nicht mehr als Spaghetti à la Miracoli und Chili con Carne kochen. Mein Salatdressing war okay, und ein Rumpsteak habe ich, na ja, nicht vollständig ruiniert. Damit kommt man als Student gut durch, aber plötzlich war ich verheiratet, Vater und irgendwie erwachsen. Meine Frau stammt aus einer durch und durch kulinarischen Familie, Vater im Feinkostgeschäft, Mutter kocht Siebeck an die Wand, irgendeine Urgroßmutter war Köchin bei »feine Leut«. Und das alles ist definitiv nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.
In einer konservativen Familienkonstellation darf ein hart arbeitender Ehemann und Vater die Früchte solcher Vorbildung ganz entspannt beim pünktlich auf den Tisch gestellten Abendessen genießen. Aber in einer modernen Beziehung sollte ein häufig arbeitsloser Schauspieler, der mit einer akademisch gebildeten und emanzipierten Frau zusammenlebt und Kinder mit ihr großzieht, ganz schnell zusehen, dass er anständig kochen lernt. Meine Frau zeigte sich bei diesem Prozess geduldig und leidensfähig. Sie motivierte mich ausschließlich durch Lob, was auf eine herausragende schauspielerische Begabung schließen lässt. Und, Wunder der modernen Pädagogik, ich wurde wirklich besser. Aber vor allem machte mir die Sache richtig Spaß.
Durch die immer wiederkehrenden Berufskrisen hatte sich überdies die Erkenntnis durchgesetzt, dass ich einen zweiten Beruf brauchte, psychisch und finanziell. Als Freunde von uns ihr erstes Restaurant eröffneten, grandioser Zufall, drängte ich mich ihnen als Hilfskoch auf. Nun zeigten sich die Nachteile des Kuschelkurses meiner Frau. Ich ging den neuen Job in brutaler Selbstüberschätzung an und wollte schnell zum gefeierten Spitzenmann des Etablissements aufsteigen.
Doch die nach klassischer Art durch Demütigung und Schweiß ausgebildeten Profis der Küche gaben ihre eigenen Erfahrungen ungefiltert an den ehrgeizigen Neuling weiter und machten in kürzester Zeit ein nervliches Wrack aus mir. Nach eineinhalb Jahren warf ich das Handtuch.
Mit der Schauspielerei lief es dann auch zeitweilig besser, und so blieb ich ein halbes Jahr abstinent. Dann traf ich bei einer Osterfeier einen Freund, den ich länger nicht gesehen hatte. Florian war seit einiger Zeit Küchenchef in Kolja Kleebergs »VAU«, und ich hörte mir schüchtern seine Erzählungen vom Krieg der Sterne an. Meine Frau gab meinem Leben einen Schubs und schickte mich zum Praktikum dorthin. »Eine Woche nur, guck’s dir mal an.«
Und in der Woche passierte es.
Ich sah und roch Essen von einer Güte und Schönheit, die ich nicht für möglich gehalten hatte, und mir wurde klar, dass man zu solcher Meisterschaft nur mit harter Disziplin und viel, viel Übung kommt. Das Koch-Virus hatte mich erwischt, und ich nutzte den ersten Fieberschub, um Nägel mit Köpfen zu machen. Kolja Kleeberg, der Capo di tutti Capi, hatte Verständnis für meine »Erkrankung«, hörte sicher auch die Meinung seiner Küchenchefs, die ich Gott sei Dank nicht kannte, klärte die Einzelheiten mit der IHK Berlin und holte sich einen übermotivierten sechsunddreißigjährigen Praktikanten ins Haus.
Wie alle Anfänger und Aficionados war auch ich wochenlang ein Meister der Verdrängung. Im gastronomischen Himmel angekommen, Meisterschüler in einer der hundert besten Küchen der (Gault-Millau-)Welt, sah ich eine strahlende Zukunft als Topfund Pfannenmagier vor mir. Die nach einem Monat einsetzende Erschöpfung und erste Frustrationen machten mir dann einen etwas nüchterneren Blick auf meine neue berufliche Realität möglich. Und die sieht so aus: Es ist heiß in der Küche, sehr heiß, es gibt kaum natürliches Licht, den ganzen Tag über rumpelt die Abzugshaube, Töpfe und Pfannen scheppern. In den Vorbereitungszeiten, der Mise en place, dröhnt meistens Techno oder Hip-Hop in Triebwerkslautstärke durch die Küche, dauernd soll man schneller und noch schneller machen, und trotzdem werden die Erledigungslisten einfach nicht kürzer.
Lieferanten kommen, der Küchenchef checkt und schimpft und handelt den Preis herunter, während das Fußvolk unzählige Kisten und Paletten verräumt. Immer mehr Essen wird in die Kühlräume gestopft, mit Köpfchen geht’s, mit Gewalt geht’s besser.
Am Anfang verbringt man ganze Tage mit aufräumen, putzen und Gemüse schnibbeln, immer wieder Gemüse schnibbeln. Alle möglichen Formen von klassischen Schnitten: Juliennes, ganz feine Streifen, Brunoises, ganz feine Würfelchen, Bâtonnets, grobe Stäbe, wie Pommes frites, Paysannes, grobe Würfel. Oder feine Scheiben von Karotten runterschneiden, zack, zack, zack. Zwiebeln und Schalotten in Ringe oder Würfel oder Blätter oder Streifen schneiden. Dabei lernt man vor allem, schnell und präzise mit dem Messer zu arbeiten. Und welches Messer man für welche Arbeit benutzt. Wenn man diese Grundtechniken gut intus hat, kommen Fleisch zerlegen, Fleisch parieren und Fisch filetieren an die Reihe. Krustentiere ausbrechen und bei Krebsen die Därme ziehen. Hummer im kochenden Wasser killen und die Scheren knacken, ohne das Fleisch zu verletzen, das ist dann schon für Fortgeschrittene.
Die Arbeitszeiten: neun Uhr dreißig umgezogen am Posten, Mise en place bis zwölf. Ab zwölf Uhr Mittagsservice bis vierzehn Uhr dreißig, meistens aber bis fünfzehn Uhr. Ein bis zwei Stunden Pause, aber nur, wenn wirklich nichts zu tun ist, was aber so gut wie nie vorkommt. Dann wieder Mise en place bis achtzehn Uhr. Pause mit Personalessen für alle Köche, Kellner und Spüler. Ab neunzehn Uhr Abendservice. An ruhigen Abenden bis halb elf, an schlimmen geht das letzte Dessert um eins aus der Patisserie raus. Nach dem Service wird die ganze Küche geputzt, alles ordentlich verräumt und durchgezählt, die Bestellungen für den nächsten Tag werden bei den Lieferanten aufs Band gequatscht, und ab nach Hause. Das ist Teildienst.
Frühdienst geht von neun Uhr dreißig bis neunzehn Uhr, Spätdienst von vierzehn Uhr bis Ende. Die Ausgelernten haben drei Mal Teildienst pro Woche und zwei Mal Frühoder Spätdienst. Zwei Tage frei.
Und wofür die ganze Plackerei? Zum Beispiel für Folgendes: Schon ab dreiviertel Zehn macht sich die Karawane der Düfte auf ihren Weg. Zum Reduzieren aufgesetzter Schmorfond, frischer Gemüsefond, Geflügelfond, Rührei fürs Personalfrühstück, die Enten im Kombidämpfer, die Wildknochen, die im Ofen rösten, für die Sauce. Aus der Patisserie ziehen Schwaden mit dem Duft von hausgemachten Baguettes nach vorne. Die Lehrlinge schneiden im Takt Gemüse klein und reden übers Wochenende, das vergangene oder das kommende.
Solange man im Zeitplan bleibt, ist Raum fürs Quatschen und fürs Lernen. Jeden Tag neue Küchenwunder. Wie setzt man Fenchelsuppe an, wie wird Heilbutt filetiert, was braucht man für eine Mousse au Chocolat, wie wird Rotweineis hergestellt, wann ist eine Kalbsjus perfekt?
Die Leute, von denen man hier lernt, haben es drauf. Brandenburger Landjungs mit Hauptschulabschluss und Kaffeekinn, Ostberliner Ex-Sprayer, Westberliner TechnoÜberlebende. Küchenchef Florian war schon bei seiner Facharbeiterprüfung Landesbester in Bayern, Stefan, sein Nachfolger, wäre bei seiner Prüfung beinahe durchgefallen, Marc war ursprünglich Galerist und hat die Kochlehre erst mit fünfundzwanzig gemacht. Alle drei sind heute absolute Spitzenmänner. Einer der Lehrlinge ist auch schon dreißig, gelernter Maurer und Kontrabassist. Er schult jetzt um auf Koch und geht in seiner spärlichen Freizeit zum Kickboxen.
Manche Tischgesellschaft gibt hier an einem Abend etwa so viel aus, wie die meisten der Köche in einem Monat netto verdienen; die Menüs, die wir kochen, kosten leicht mal hundertdreißig Euro; und die Gäste finden das gar nicht so teuer. Nicht nur, weil Gäste in Sternerestaurants eben Geld haben, sondern vor allem, weil es nicht viele Orte gibt, an denen man so gutes Essen bekommt. Essen, dessen Geschmack Menschen überwältigt.
Wenn man zu Beginn der Ausbildung gelegentlich beim Abendservice zuschaut, versteht man gar nichts. Kellner annoncieren Gäste und Tischnummern, die Köche verständigen sich über zwei Herde hinweg rufend, der Chef am Pass spricht eine unverständliche Sprache. In ungeheurer Geschwindigkeit wird Essen kunstvoll auf Tellern arrangiert, fliegen Löffel in Schlenkern über die Kunstwerke und tropfen kräftig-aromatische Saucen zu präzise abgezirkelten Klecksen, Streifen und Kreisen zwischen die Köstlichkeiten.
Es entsteht der Eindruck von Zufälligkeit, aber tatsächlich ist jedes Gericht nach genauen Regeln und Vorstellungen geschmacklich und optisch komponiert. Und der Anfänger spürt schmerzhaft: Egal, wie weit der Weg noch sein mag, das ist es!
Nach Monaten der Grundausbildung, nach langsamem Start im Mittagsgeschäft ist es dann so weit. Der erste Abendservice steht an, die Feuertaufe. Sie verläuft in der Regel furchtbar. Zu viel auf einmal wird verlangt. Die Bons im Blick haben, vorausdenken, nicht die kleinste Kleinigkeit vergessen. Man muss eigentlich die ganze Karte im Kopf haben, zum Nachgucken ist keine Zeit. Welche Beilagen zu welchem Fleisch oder Fisch? Das eine gibt man halb roh zum Chef, das andere vergisst man im Ofen. Debakel reiht sich an Debakel. Auch noch bei den nächsten Versuchen. Aber wenn man dranbleibt, sich festbeißt und wenigstens kleinste Fortschritte zeigt, bekommt man immer wieder eine neue Chance. Und irgendwann ist der Abend da, an dem alles klappt. Nichts vergessen, nichts verbrannt, alles gut abgeschmeckt, nach dem letzten Teller klatscht der Postenchef ab und sagt: »Geiler Service, Mann!« Danach ein Bier, vom Chef persönlich gezapft, »aber nicht durchdrehen jetzt, Junge«, aufräumen, Bestellung machen, umziehen, ab aufs Fahrrad. Das Grinsen kriegt man auf dem ganzen Heimweg nicht mehr aus dem Gesicht. Und morgen geht’s von vorne los.
Nachdem der Capo di tutti Capi, seine Küchenchefs Florian, Marc und später Steppel, mein erster Postenchef Denny, außerdem Killah, Holger, Ferdi, Steffen, Ela und noch ein paar andere nervenstarke Küchenprofis sich zwei Jahre mit mir herumgeschlagen hatten, war es dann so weit: Ende August 2006 bestand ich vor der IHK Berlin die Abschlussprüfung und darf mich seitdem ernsthaft »Koch« nennen und schwarze Knöpfe an meiner Kochjacke tragen. Eine Karriere im Zweitberuf habe ich mir dennoch abgeschminkt. Ich bin zu alt und zu bequem, um mich jetzt noch auf die dafür nötige jahrelange Ochsentour durch zig Küchen zu begeben. Aber der Virus ist latent. Wenn ich essen gehe, versuche ich immer einen Blick in die Küche zu werfen. Selbst schlechte Kochsendungen – und die meisten sind schlecht, weil sie nicht von Köchen, sondern von Fernsehleuten konzipiert werden – fesseln mich an den Fernseher.
Ich bin immer noch mit Kollegen aus der Lehre befreundet und verfolge ihren Weg sowohl mit Neid als auch schlechtem Gewissen, als hätte ich Kriegskameraden im Stich gelassen und mich auf einen Etappenposten gerettet. Jetzt bin ich nur noch ferner Zeuge ihrer Taten.
Was mich am meisten beeindruckt hat in meinen bisherigen Küchenjahren, sind die Hingabe und der ungeheure Handwerkerstolz, mit dem in der Spitzengastronomie gearbeitet wird. Und zwar von jungen Leuten, die ja heutzutage angeblich für alles zu faul und zu oberflächlich sind. Selbst das Mittagessen für die Spüler, meist Afrikaner, wird mit Liebe gekocht, fein angerichtet und mit Respekt für geschmackliche oder kulturell bedingte Vorlieben ausgesucht.
Der ungeheure Kochboom der letzten Jahre hat diesen Berufsstand wie kaum einen anderen ins Licht der Öffentlichkeit gestellt. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen sind viele Klischees und Missverständnisse im Umlauf, und ich glaube, dass nach wie vor nur wenige Nicht-Köche eine realistische Vorstellung von gastronomischer Arbeit haben. Deshalb will ich mich jetzt auf Wanderschaft durch deutsche Profiküchen begeben. Ich will sehen, erleben und berichten, wie es in Kantinen und Kneipen, Kombüsen und Kaschemmen zugeht, und was Köchinnen und Köche dort leisten.
Ich möchte herausfinden, ob sich das mittlerweile beinahe hysterische Interesse für Küche und Ernährung in der gastronomischen Wirklichkeit niederschlägt, ob die Deutschen heute besser als früher kochen und essen und ob sie auch mehr von ihren Profiköchen verlangen. Ob die Beliebtheit ausländischen Essens unsere Gesellschaft ein bisschen ausländerfreundlicher macht.
Um sentimentale Erinnerungen an eine aufregende und sehr prägende Lebensphase auf ihren Realitätsbestand zu überprüfen, um dem ungeheuren Kochboom und seinen Ursachen und Folgen ein wenig auf den Grund zu gehen und um einfach mal wieder Zeit mit Köchinnen und Köchen, jenen heldenhaften Dienern am Bauch, zu verbringen, mache ich mich auf eine Reise, deren Ergebnis offen ist. Ich bin gespannt.
Gregor Weber, geboren 1968, studiert nach Abitur und Wehrdienst Schauspiel. Lange Jahre ist er als Fernsehschauspieler tätig - u.a. als Sohn Stefan der "Familie Heinz Becker" und im "Tatort" des Saarländischen Rundfunks. Außerdem hat er mehrere Kriminalromane veröffentlicht. Mit 36 Jahren ließ er sich im Berliner Sternerestaurant "VAU" zum Koch ausbilden. Seit 2018 ist Gregor Weber als Soldat bei der Bundeswehr tätig.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783945944097458270
- Artikelnummer SW9783945944097458270
-
Autor
Gregor Weber
- Verlag makrobooks
- Veröffentlichung 19.04.2021
- ISBN 9783945944097
- Verlag makrobooks