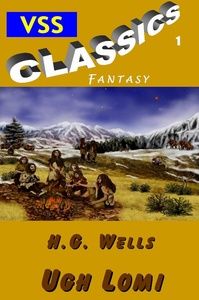Ugh-Lomi
Die Erzählung spielt während der Steinzeit und erzählt von einem Höhlenmenschen namens Ugh-Lomi, der sich mit der jungen Frau Eudena verbindet und seinen Rivalen, den De-facto-Stammesführer Uya, tötet. Im Exil wird Ugh-Lomi der erste Mann, der ein Pferd reitet und Stein und Holz zu einer Axt kombiniert. Er benutzt diese Waffe zusammen mit seinem Verstand, um Begegnungen mit Höhlenbären, Hyänen und Nashörnern zu überleben und letztendlich die Position des Stammesführers für sich selbst zu beanspruchen.
Die Geschichte wurde in drei Teilen zwischen Mai und August 1897 in The Idler Magazin vorgestellt und wurde später in Sammelausgaben veröffentlicht.
Die Erzählung spielt während der Steinzeit und erzählt von einem Höhlenmenschen namens Ugh-Lomi, der sich mit der jungen Frau Eudena verbindet und seinen Rivalen, den De-facto-Stammesführer Uya, tötet. Im Exil wird Ugh-Lomi der erste Mann, der ein Pferd reitet und Stein und Holz zu einer Axt kombiniert. Er benutzt diese Waffe zusammen mit ...
Diese Geschichte reicht in die Zeit vor Menschengedenken zurück, in Zeiten, in denen man noch trockenen Fußes von Frankreich (wie wir es jetzt nennen) nach England hätte gehen können, und in denen die Themse breit und träge durch ihr Sumpfland floss, um Vater Rhein zu begegnen, der durch ein weites, ebenes Land strömte, das in unseren Tagen unter Wasser steht und unter dem Namen Nordsee bekannt ist. In jenen Zeiten bestand das Tal noch nicht, das sich am Fuße der Downs entlang zieht, und den Süden von Surrey bildete eine Reihe von Hügeln, deren mittlere Hänge fichtenbewachsen und die den größten Teil des Jahres schneegekrönt waren. An den unteren Hängen der Kette, unterhalb der grasbewachsenen Plätze, wo die wilden Pferde weideten, lagen Wälder von Eichen, Ulmen und Edelkastanien, und in den Dickichten und finsteren Verstecken verbargen sich Grizzlybären und Hyänen, und graue Affen kletterten in den Zweigen. Und noch tiefer, zwischen Sumpfland, Wäldern und offenen Wiesen, längs des Weys, spielte sich dieses kleine Drama, das ich erzählen will, von Anfang bis Ende ab. Fünfzigtausend Jahre ist es her, fünfzigtausend Jahre – wenn man sich auf die Rechnung der Geologen verlassen kann.
Der Frühling war in jenen Tagen ebenso fröhlich wie jetzt und brachte das Blut in Wallung, genauso wie heute. Der Himmel war blau am Nachmittag, weiße Schäfchenwolken segelten über ihn, und der Südwestwind kam wie eine sanfte Liebkosung. Die jüngst heimgekehrten Schwalben flogen hin und her. Die Ufer des Flusses waren mit weißen Ranunkeln besät und die sumpfigen Stellen waren voll mit Wiesenkresse, und Samtpappeln leuchteten hervor, wo die Schwerter des Riedgrases es zuließen. Die nordwärts ziehenden Flusspferde, glänzend schwarze Ungeheuer, trieben plump ihr Spiel und kamen mit einem vagen Gefühl der Freude daher, überall herumpatschend und -klatschend, und nur von dem einen klaren Gedanken besessen, das Wasser des Flusses trüb zu spritzen.
Flussaufwärts, nicht weit von den Flusspferden entfernt, plantschten eine Menge kleine, ledergelbe Tiere im Wasser. Es herrschte weder Angst noch Feindschaft zwischen ihnen und den Flusspferden. Wenn die großen Ungetüme durch das Schilf daher getrampelt kamen und den Wasserspiegel in Silbersplitter zerschlugen, schrien und tobten diese kleinen Geschöpfe vor Freude. Es war das sicherste Zeichen des vollen Frühlings. „Buluh!“, riefen sie. „Baajah! Buluh!“ Es waren die Kinder des Menschenvolks, von dessen Lagerplatz auf dem Hügel am Flussknie der Rauch aufstieg. Wildäugige Burschen waren es, mit verfilztem Haar und kleinen, breitnasigen Koboldgesichtern, die (wie manche Kinder sogar heutzutage noch) mit einem zarten Flaum kleiner Härchen bedeckt waren. Sie waren schmal in den Hüften und hatten lange Arme. Ihre Ohren hatten keine Läppchen, sondern kleine, spitzige Zipfel, etwas, das auch jetzt noch manchmal vorkommt. Splitternackte, ausgelassene kleine Zigeuner, beweglich wie Affen, und wie diese immerzu am Schnattern, obwohl es ihnen ein wenig an Worten mangelte.
Die Älteren des Stammes waren den sich wälzenden Flusspferden durch den Hügelkamm verborgen. Der Siedlungsplatz der Menschen bestand aus niedergestampftem Boden inmitten von toten, braunen Zweige der Königsfarne, zwischen denen sich die neuen Blüten des Bischofsstabes in Licht und Wärme entrollten. Das Feuer war ein rauchender, kohlender Haufen, hellgrau und schwarz, den die alten Frauen von Zeit zu Zeit mit braunen Blättern neu anfachten. Die meisten Männer schliefen – sitzend, die Stirn auf den Knien. Sie hatten diesen Morgen auf der Jagd gute Beute gemacht, ein Wild, das von jagenden Hunden verwundet worden war, für alle genug; so gab es also keinen Streit unter ihnen, und einige Frauen nagten noch an den Knochen, die verstreut worden waren. Andere machten aus Blättern und Ästen einen Haufen, um „Bruder Feuer“ zu füttern, damit er davon groß und stark werde, wenn die Dunkelheit wiederkäme, und sie vor den wilden Tieren schütze. Und zwei stapelten Kieselsteine auf, die sie vom Ufer des Flusses, wo die Kinder spielten, herbeitrugen, einen ganzen Arm voll auf einmal.
Keiner von diesen lederhäutigen Wilden war bekleidet, aber manche trugen grobe Gürtel aus Schlangenhaut um die Hüften oder knisternde, unbearbeitete Häute, an denen kleine Beutel hingen, die aus abgerissenen Tierpfoten gemacht waren. Darin trugen sie die roh behauenen Feuersteine, die damals die Hauptwaffen und -werkzeuge der Menschen waren. Und eine Frau, die Gefährtin Uyas, des „Schlauen Mannes“, trug eine wundervolle Halskette von aufgereihten Steinen – die schon andere vor ihr getragen hatten. Neben einigen der schlafenden Männer lagen die großen Geweihe des Elches, deren Zacken an den Kanten scharf gemacht, und lange Stöcke, deren Enden mit Steinen zu scharfen Spitzen gehauen waren. Außer diesen Dingen und dem rauchenden Feuer gab es wenig, was die menschlichen Geschöpfe von den wilden Tieren unterschied, die rings umher das Land durchstreiften. Aber Uya der Schlaue schlief nicht. Er saß da, einen Knochen in der Hand, und schabte emsig mit einem Feuerstein daran herum – kein Tier hätte so etwas getan. Er war der älteste Mann des Stammes, mit buschigen Augenbrauen und dünnen, langen Armen. Er hatte einen Bart und seine Wangen waren haarig, und Brust und Arme waren dicht mit schwarzem Haar bedeckt. Sowohl wegen seiner Stärke als auch seiner Schlauheit willen war er Herr des Stammes, und sein Anteil war stets der größte und der beste.
Judina hatte sich zwischen den Erlen versteckt, denn sie fürchtete sich vor Uya. Sie war noch ein Mädchen, ihre Augen waren hell, und ihr Lächeln war lieblich anzusehen. Er hatte ihr ein Stück von der Leber gegeben, ein Stück für Männer, eine gar herrliche Mahlzeit für ein Mädchen. Aber als sie es genommen hatte, sah die andere Frau, die mit der Halskette, sie mit einem bösen Blick an, und Ugh-lomi ließ einen gurgelnden Laut hören. Daraufhin hatte ihn Uya lang und fest angesehen und Ugh-lomis Blick hatte sich gesenkt. Dann hatte Uya sie angesehen. Sie hatte Angst bekommen und sich fortgeschlichen, während die anderen weiter aßen und Uya sich emsig mit dem Mark eines Knochens beschäftigte. Später war er herumgelaufen, als wollte er nach ihr sehen. Und jetzt hockte sie unter den Erlen und fragte sich immer wieder, was Uya wohl mit dem Stein und dem Knochen anstellen würde. Und Ugh-lomi war nicht zu sehen.
Plötzlich kam ein Eichhörnchen zwischen den Erlen hervorgesprungen, und Judina lag so still da, dass der kleine Mann nur noch sechs Fuß von ihr entfernt war, ehe er sie sah. Da hob er hastig einen Zweig auf und begann zu schnattern und zu schimpfen. „Was machst du denn da, abseits von den anderen Menschentieren?“, fragte er. „Still!“, sagte Judina, aber er schnatterte nur noch mehr, und da begann sie die kleinen, schwarzen Tannenzapfen abzubrechen und nach ihm zu werfen. Er sprang kreuz und quer, um sie zu ärgern, und forderte sie heraus, was Judina nur noch mehr anstachelte. Sie sprang auf, um besser werfen zu können, und da sah sie Uya, der den Hügel herunterkam. Er hatte die Bewegung ihres blassen Armes im Dickicht gesehen – er hatte sehr scharfe Augen.
Darüber vergaß sie das Eichhörnchen und machte sich zwischen Erlen und Schilfrohr davon, so schnell sie nur konnte. Es war ihr gleichgültig, wohin sie kam, wenn sie nur Uya entkam. Sie watete fast knietief durch eine sumpfige Stelle und sah vor sich einen Abhang voll Farnkräuter, die dünner und grüner wurden, je weiter sie aus dem Licht in den Schatten der jungen Kastanienbäume kamen. Bald war sie inmitten der Bäume – sie hatte sehr flinke Beine und sie lief weiter und immer weiter, bis der Wald dichter wurde und die Täler tiefer. Dort, wo das Licht hinfiel, waren die Weinranken um die Stämme herum dick wie junge Bäume und die Efeuranken stark und dicht. Und Judina lief immer weiter und immer schneller, bis sie sich endlich zwischen einige Farne in eine kleine Mulde neben einem Dickicht legte und horchte, während ihr das Herz in den Ohren pochte.
Plötzlich hörte sie Schritte im welken Laub rascheln, weit weg, und dann erstarben sie wieder und alles war still, bis auf das Schwirren der Mücken (denn der Abend brach herein) und das unaufhörliche Wispern der Blätter. Heimlich lachte sie bei dem Gedanken, dass der schlaue Uya an ihr vorbeigehen könnte. Sie hatte keine Angst. Schon so manches Mal, wenn sie mit den anderen Jungen und Mädchen gespielt hatte, war sie in den Wald geflohen, allerdings noch niemals zuvor so weit wie jetzt. Es war lustig, versteckt und allein zu sein.
Lange Zeit lag sie da und freute sich, dass sie entwischt war; dann setzte sie sich auf und horchte.
Herbert George Wells (meist abgekürzt H. G. Wells; geboren 21. September 1866 in Bromley; gestorben 13. August 1946 in London) war ein englischer Schriftsteller und Pionier der Science-Fiction-Literatur. Wells, der auch Historiker und Soziologe war, hatte seine größten Erfolge mit den beiden Science-Fiction-Romanen (von ihm selbst als "scientific romances" bezeichnet) "Der Krieg der Welten" und "Die Zeitmaschine". Wells ist in Deutschland vor allem für seine Science-Fiction-Bücher bekannt, hat aber auch zahlreiche realistische Romane verfasst, die im englischen Sprachraum nach wie vor populär sind.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783961271009458270
- Artikelnummer SW9783961271009458270
-
Autor
H. - G. Wells
- Mit Sarah Schmidt
- Verlag vss-verlag
- Seitenzahl 75
- Veröffentlichung 21.04.2018
- ISBN 9783961271009
- Mit Sarah Schmidt