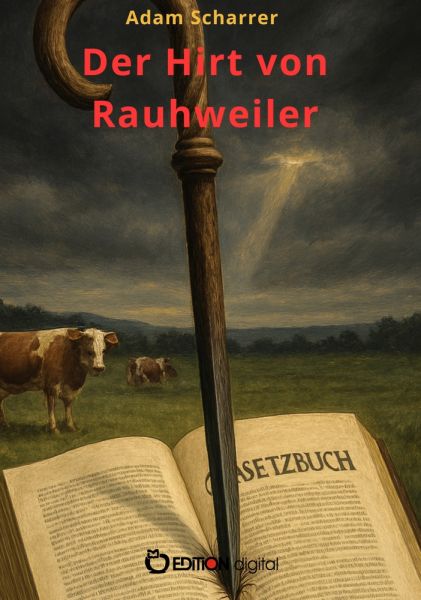Der Hirt von Rauhweiler
Ein Dorf im Umbruch. Eine junge Frau, ein Hirte – und der Mut, nicht zu schweigen.
In dem Roman entfaltet Adam Scharrer ein kraftvolles Panorama des dörflichen Lebens im ausgehenden 19. Jahrhundert – rau, archaisch und durchdrungen von sozialen Spannungen. Im Mittelpunkt stehen zwei außergewöhnliche Figuren: Eva Illenschauer, Tochter eines verachteten Schinders, klug, unbeugsam, ausgegrenzt. Und Franz Leikant, ein ehemaliger Soldat, der als Hirt für seine Familie, für Gerechtigkeit und für seine Würde kämpft.
Zwischen Stall und Gerichtssaal, zwischen Skandal, Liebe und sozialem Aufbegehren geraten sie in ein Netz aus Vorurteilen, Intrigen und Machtmissbrauch. Doch sie lassen sich nicht brechen – weder von patriarchaler Gewalt noch vom Schweigen einer ganzen Gemeinde.
Adam Scharrer erzählt in eindrucksvollen Bildern von sozialer Ausgrenzung, stillem Widerstand und der Sehnsucht nach einem besseren Leben. Ein literarisches Zeitzeugnis voller Relevanz – und ein leidenschaftlicher Appell für Menschlichkeit, Wahrheit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.
Zwei Tage, rechnete Franz, würde der Brief bis Rauhweiler gehen. Wenn Lene sofort antwortete, konnte er ihren Brief in vier Tagen haben. Einen Tag Überlegung, das wären fünf Tage. Wenn Lene der Mensch war, für den er sie hielt, würde sie ihn, ganz gleich, wie sie über ihn und sein Anerbieten dachte, nicht unnötig warten lassen. Ließe sie dennoch nichts von sich hören, nun, so würde das ein Zeichen dafür sein, dass er sich eben geirrt und gar nichts zu bereuen hatte. Mit diesen Zweifeln und Hoffnungen trug er den Brief zur Post, machte seinen Dienst weiter, ging schlafen, stand auf … Und als am fünften Tage nach der Absendung seines Briefes die Post ausgeteilt wurde und für ihn nichts dabei war, konnte er dies nicht gleich fassen. Er hatte im Stillen gehofft, dass Lene sehnsüchtig einen Brief von ihm erwartete und, da in diesem Falle doch so viel für beide Teile auf dem Spiel stand, sofort antworten würde und später ja ausführlich schreiben könnte. Aber vielleicht war kein Papier oder keine Tinte bei der Hand? Oder die Briefe wurden in dem entlegenen Dorf nicht jeden Tag abgeholt? Oder Lene wollte von ihm nicht dafür angesehen werden, dass sie es eilig hatte, geheiratet zu werden? Wahrhaftig Gründe genug, einen Tag länger zu warten … Aber auch am anderen Tag kam kein Brief, am folgenden wieder nicht …
Wieder kam ein Sonntag und wieder wurde zum Postempfang aufgerufen, und wieder hatte Franz vergebens gehofft. Auch gut! versuchte er sich einzureden. Irren ist menschlich. Was ist denn schon verloren? Fünf Pfennig für Porto und weiter nichts! Aber es gelang ihm nicht, sich seine Enttäuschung auszureden. Nun erst, da er berechtigten Grund zum Zweifel hatte, fühlte er, wie schmerzlich diese Enttäuschung war. Ganz krank fühlte er sich. Vielleicht lachten sie jetzt in Rauhweiler über ihn. Sollen sie! Er wird dieser Lene einen Brief schreiben, den sie sich wahrhaftig nicht hinter den Spiegel steckt. Dass er sich in sie vergafft hatte, dessen brauchte er sich verdammt nicht zu schämen; aber dass sie ihm noch nicht einmal anstandshalber antwortete, zeigte doch, dass der Brief mit der Einladung ein albernes Getue war!
Grund genug, den Brief aufs Neue zu lesen – und in neue Zweifel zu verfallen. Mühsam war Buchstabe an Buchstabe gereiht, und Lene und der Alte mussten mit Andres sehr ausführlich gesprochen haben, sonst hätte dieser das nicht alles so ausführlich zu Papier bringen können. Sie mussten sogar noch während des Schreibens mit ihm gesprochen haben: Ein Brief von so schwerer Hand an einen unbekannten Menschen wird doch sonst nicht so lang? Und nach langem Grübeln stellte sich Franz die ganze Geschichte wieder anders dar. Der Brief konnte gut gemeint und grundehrlich sein, weil die Leute ihn für einen anständigen Menschen hielten. Hatte er darum ein Anrecht auf Lene? Konnte sie nicht längst einem andern, diesem David womöglich, versprochen sein? War denn gerade sie verurteilt zu warten, bis sich eine Einquartierung nach Rauhweiler verirrte? Und nun wollte sie ihm vielleicht nicht weh tun, überlegte hin und her, er hatte ihr ja geschrieben, bis wann er die Antwort haben musste, und bis dahin waren noch drei Tage Zeit. Vielleicht war ihre Antwort schon unterwegs, lag auf der Post, aber es wird eine Absage sein, kann nur eine Absage sein, im andern Falle wäre eine solch lange Überlegung ja nicht nötig. Damit hieß es sich eben abfinden.
Wieder – wie an allen Sonntagnachmittagen – leerte sich die Stube. In sauber gebürsteten Uniformen, mit blitzblanken Knöpfen und Sporen, verließen die Kameraden die Kaserne. Franz zählte sein Geld, es waren siebenundzwanzig Pfennig. Er ging in die Kantine, trank ein Glas Bier, kaufte sich sieben Zigaretten und für zehn Pfennig Schmalz zum Kommissbrot. Einige Kameraden betrachteten interessiert die zum Verkauf ausgestellten buntbebänderten Reservistenstöcke, mit denen die entlassenen „alten Knochen“ abzogen.
Für Franz waren diese Dinge und die sich an sie knüpfenden Gespräche von zweifelhaftem Reiz, und die Kameraden wussten es. Er, als Kapitulant, würde ja hierbleiben, würde die neueinrückenden Rekruten auf Pferden ohne Sättel in der Reitbahn herumjagen, bis sie sich den Hintern durchgehopst hatten. Manche wunderten sich wohl darüber, dass Franz sich dazu entschlossen hatte, aber sie hüteten sich, ihn zu fragen. Ein abfälliges Wort konnte böse Folgen haben.
Als Franz im Begriff war, missmutig die Kantine zu verlassen, kam einer der Rekruten vom jüngsten Jahrgang auf ihn zu und fragte ihn: „Bist du der Leikant?“ – „Ja. Was willst du?“ – „Du sollst einmal hinauskommen vors Tor. Dort will dich jemand sprechen.“ – „Wer will mich sprechen?“, fragte Franz unwirsch. – „Lene heißt sie, hat sie gesagt.“
Franz war plötzlich ganz fassungslos, und die Antwort des Rekruten bewirkte ein vieldeutiges Lächeln der Reservisten. Das also war der Grund, warum der Leikant kapitulierte! Da wartete eine Vaterschaft auf Anerkennung, und da der nette Bräutigam sich nicht mehr hören und sehen ließ, blieb dem betrogenen Mädchen nichts anderes übrig, als ihn aufzusuchen und ihn nachdrücklichst an seine Pflichten zu erinnern!
„Trink aus!“, sagte Franz in freudigem Schreck und schob dem Rekruten den Rest seines Bieres zu. Dann reichte er ihm eine Zigarette: „Und da, rauch an, und dann lauf zurück und sag ihr, ich komme auf der Stelle. Ich muss mich nur schnell umziehen!“ Mit riesigen Schritten eilte Franz aus der Tür, über den weiten Hof in seine Stube. Er hatte weder Stiefel noch Sporen noch Knöpfe geputzt. Nicht einmal rasiert war er. Wie hatte er auch an Ausgang denken können! Zum Glück saßen in der Stube einige Rekruten; denen warf er Stiefel und Sporen und Waffenrock hin und sagte: „Ihr müsst mir helfen, Kameraden. In fünf Minuten muss ich fertig sein. Fasst zu, ihr sollt es nicht umsonst tun!“ Und den einen, der gelegentlich für einen Löffel voll Schmalz oder für eine Zigarette rasierte, forderte er auf: „Mach mich glatt! Aber schnell. Da!“ Er legte dem Rasierer drei Zigaretten hin und setzte sich breitbeinig zurecht.
Die Kameraden machten sich lachend und verwundert an ihre Arbeit. „Hast ein Telegramm bekommen, dass du eine Erbschaft antreten sollst?“, fragte einer. „Oder das große Los gewonnen?“, ein anderer.
„Ja!“, triumphierte Franz. „Ein Telegramm. Der Telegrafenbote steht noch unten. Ich soll eine Erbschaft in Rauhweiler antreten, wo wir in Quartier waren. Aber macht nur, macht nur! Und du, seif nicht so lange. Mach, dass du sie runterkriegst, die paar Haare!“ Und dann musste Franz alle Witzeleien und Sticheleien still über sich ergehen lassen, denn jede Erwiderung hätte eine Unterbrechung der Arbeit des Verschönerungsrates und eine weitere Verzögerung bedeutet. Er hörte nur, wie mit Bürsten und Lappen Stiefel, Uniform, Knöpfe und Sporen bearbeitet wurden. Der Barbier hatte kaum das Messer von seinem Gesicht genommen, als Franz aufsprang, sich wusch, anzog, einen Blick in den Spiegel warf, die Tür aufriss und, so rasch er konnte, die Steinstufen hinunterlief.
Adam Scharrer wurde am 13. Juli 1889 in Kleinschwarzenlohe (heute Gemeinde Wendelstein, Mittelfranken) geboren. Bereits in frühen Jahren prägte ihn das harte Leben der Arbeiterklasse. Nach einer Schlosserlehre führte ihn seine Arbeitssuche durch zahlreiche deutsche Städte sowie nach Österreich, die Schweiz und Italien. Während des Ersten Weltkriegs wurde er als Artillerist an die Ostfront eingezogen. Seine Erfahrungen als Soldat und seine Enttäuschung über die sozialdemokratische Zustimmung zu den Kriegskrediten radikalisierten seine politische Haltung. Er trat dem Spartakusbund bei und engagierte sich später in der linksradikalen KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands).
Scharrer begann in den 1920er-Jahren mit dem Schreiben. Seine erste Erzählung "Weintrauben" (1925) wurde anonym veröffentlicht und brachte ihm eine Anklage wegen "literarischen Hochverrats" ein. Seine Werke sind stark autobiografisch geprägt und erzählen aus der Perspektive der unteren Gesellschaftsschichten. 1930 erschien sein wohl bekanntestes Werk "Vaterlandslose Gesellen", eine proletarische Antwort auf Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues". Der Roman ist eine schonungslose Abrechnung mit dem wilhelminischen Militarismus und dem Ersten Weltkrieg.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 musste Scharrer untertauchen und floh zunächst in die Tschechoslowakei, dann in die Sowjetunion. Dort lebte er in einer Autorenkolonie und schrieb weiter über die Nöte der Arbeiter und Bauern. Während seines Exils entstanden unter anderem "Maulwürfe" (1934), "Pennbrüder, Rebellen, Marodeure" (1937) und "Der Krummhofbauer und andere Dorfgeschichten" (1939).
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Scharrer 1945 nach Deutschland zurück und ließ sich in Schwerin nieder. Er arbeitete als Redakteur der "Schweriner Landeszeitung" und wurde Leiter der Literatursektion im Kulturbund. Trotz seiner politischen Nähe zur Arbeiterbewegung trat er keiner Partei bei.
Adam Scharrer starb am 2. März 1948 in Schwerin an den Folgen eines Herzanfalls, der durch eine hitzige Debatte über den Umgang mit der NS-Vergangenheit ausgelöst wurde. Er hinterließ ein umfangreiches literarisches Werk, das in der DDR große Verbreitung fand und als wichtiger Beitrag zur proletarischen Literatur gilt.
Seine Bücher, darunter "Vaterlandslose Gesellen", "Der große Betrug" und "In jungen Jahren", geben bis heute Einblicke in das Leben und die Kämpfe der Arbeiterklasse und bleiben ein wichtiges Zeugnis der deutschen Literaturgeschichte.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783689124571458270
- Artikelnummer SW9783689124571458270
-
Autor
Adam Scharrer
- Wasserzeichen ja
- Verlag EDITION digital
- Seitenzahl 725
- Veröffentlichung 15.04.2025
- ISBN 9783689124571
- Wasserzeichen ja