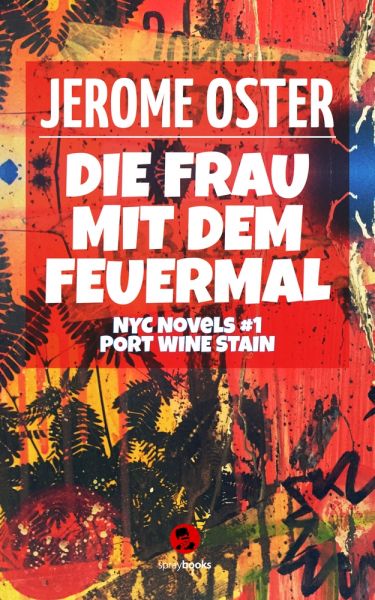Die Frau mit dem Feuermal
Port Wine Stain
Seinen ersten Kriminalroman veröffentlichte Jerome Oster, 1943 in New Mexico geboren, vor fast 30 Jahren. Der Titel der ersten deutschen Ausgabe lautete »New York Babylon«, und rückblickend war damit bereits das durchgängige Thema des Autors benannt: New York – die Großstadt schlechthin, pulsierend, brodelnd, schrill und stets in maximalem Tempo.
Ein Ehepaar überrascht einen Einbrecher in ihrer Wohnung. Es kommt zum Kampf, an dessen Ende zwei Tote zurückbleiben: der Einbrecher und der Hausherr. Die Ehefrau überlebt. Für die Polizei ist der Fall klar, aber der Reporter Charles Ives hat seine Zweifel, was den Tathergang betrifft. Er macht sich daran, das Puzzle einer recht verworrenen Geschichte zusammenzufügen …
1
Der Film war kurz und der Regen zu heftig, um noch lange herumzuschlendern. Deshalb tauchte ich eine halbe Stunde zu früh in der Redaktion auf. Ich setzte mich in die Cafeteria, trank eine Tasse von dem Gebräu, das aus dem Kaffeeautomaten kam, und las den New Yorker, bis meine Schicht anfing.
In der Lokalredaktion machte sich Hoffnung breit, dass für den Rest der Nacht nichts mehr passieren würde. Zwei feste Redakteure lieferten sich vor mehreren Zuschauern ein Schachduell, andere verfolgten im Fernseher ein Baseballspiel, das aus einer trockeneren Stadt übertragen wurde, wieder andere lasen irgendwas, ein paar Reporter hingen an den Telefonen, aber ihr breites Grinsen und ihre Gesten machten deutlich, dass sie eher flirteten als arbeiteten.
Ich setzte mich an einen Schreibtisch und blätterte die erste Ausgabe durch; wie gewöhnlich las ich im Wesentlichen nur die Bildunterschriften.
»Lahme Nacht«, sagte ich.
Reese sah nicht von seinem Kreuzworträtsel auf. »Bei Regen trauen sich die schrägen Vögel nicht raus. Ich liebe den Regen.«
»Ist aber ganz nett draußen. Ich bin zu Fuß hergelaufen.«
»Wie jetzt? Vom Village?« Er zerdehnte das letzte Wort; wie die meisten besseren Zeitungsleute wohnte er außerhalb und bekam von Manhattan nur die Strecke zu sehen, die er jeden Tag zwischen U-Bahn-Station und Büro pendelte. Er hatte sich erfolgreich eingeredet, das Village sei ein perverser Sumpf.
»Von der Fifty-Seventh Street. Ich war im Kino.«
Nach dem Film erkundigte Reese sich nicht; er hielt an seiner falschen Annahme fest: Er glaubte, ich würde die meisten meiner Nachmittage im Museum of Modern Art verbringen und mir bulgarische Filme ohne Untertitel ansehen.
Im Fernseher fing ein Spieler den Ball; wirklich tolle Sache. Sie wiederholten die Szene dreimal, bis es nur noch wie Routine aussah. »Super, dass Baseball wieder im Kommen ist. Da fühle ich mich doch gleich wieder wie ein Junge.«
Reese schnaubte verächtlich. »Barfüßiger Junge mit grauen Strähnen.« Nach einer Weile sagte er: »Wer hat Ode an die Nachtigall geschrieben?« Er versuchte es so klingen zu lassen, als wüsste er es und wollte mir nur eine Chance geben, mein Wissen unter Beweis zu stellen.
»Shelly.«
»Fünf Buchstaben. Kluges Kerlchen.«
»Keats.«
Er malte die Buchstaben in die Luft. »Nee, passt nicht, Broadway-Waise … das muss Annie sein.«
»K-e-a-t-s.«
Er strahlte. »Ich hatte recht. Die Waise Annie.« Mit dem Kinn deutete er in eine andere Ecke des Raumes. »Wo wir grad dabei sind … hast du schon unseren Neuzugang gesehen? Sie heißt Ann Roth. Quinlan hat sie von Newsweek abgeworben.«
Ich entdeckte eine Frau mit kurzem, dichtem Blondschopf, die sich konzentriert über eine Schreibmaschine beugte. Zwischen einzelnen Attacken auf die Tasten fuhr sie sich mit den Fingern durch die Haare.
»Was schreibt sie denn mit solcher Begeisterung? Hast du ihr nicht gesagt, dass wir Nachtmenschen ausgesprochen wählerisch sind?«
»Es geht um eine Todesanzeige in der Times.«
»Unsere Leser lesen die Times nicht.«
»Nein, aber unser Boss.«
»Zum Teufel mit ihm.«
»Du hast gut reden, Charlie. Du kriegst ja seine Memos nicht.«
Ich ließ ihn in Ruhe. Sein mangelndes Vertrauen in sein eigenes Urteil, was in die Zeitung sollte, war unter Nachtredakteuren wie eine ansteckende Krankheit. In diesem Augenblick sorgte sich wahrscheinlich irgendwer bei der News, dass er eine Story auf Seite sechsundzwanzig hatte, die wir auf Seite eins brachten, und jemand bei der Times versuchte eine Lücke auf der Titelseite zu finden, wo er eine Story einschieben konnte, die im zweiten Teil der ersten Ausgabe gestanden hatte, die aber der Herald auf Seite drei gebracht hatte. Beim Herald dachte jemand, dass die Times schon recht gehabt hatte, und überlegte, ob er die Story nicht auf eine unbedeutendere Position weiter hinten abschieben sollte. In manchen Nächten sprang eine Story so durch alle Ausgaben der Zeitungen, weil die jeweiligen Chefredakteure einer nach dem anderen auf das reagierten, was seine Kollegen getan hatten. Eigentlich sollte dieser Jongleurakt dem Leser zugutekommen, aber da nur diejenigen vier Zeitungen lesen, die wissen wollen, ob auch ja ihre Namen drinstehen, bestand die eigentliche Leserschaft aus Quinlan und den anderen leitenden Redakteuren, die auf ihren langen Fahrten aus den Vororten genug Zeit hatten, die Konkurrenzblätter durchzusehen, und am meisten genossen sie die Fahrt, wenn alle Zeitungen genau gleich ausschauten.
Ich zog an einen anderen Schreibtisch um, legte die Füße hoch und suchte im New Yorker die Stelle, wo ich aufgehört hatte zu lesen. Ich las nicht gleich weiter, sondern beobachtete noch ein bisschen Ann Roth, die jetzt ihre Story zu Reese brachte.
Sie trug die diesjährige Uniform der jungen Journalistin: kurze Tweedjacke über Seidenbluse, einen Rock, der knapp bis ans Knie reichte, und dazu hohe Lederstiefel. Die Uniform hatte sich während meiner zwanzig Jahre bei der Zeitung häufig gewandelt – die derzeit aktuelle hatte Designer-Jeans und T-Shirts mit irgendwelchen kryptischen Aufdrucken abgelöst –, aber nicht geändert hatte sich, dass eine Frau einen Raum nicht durchqueren konnte, ohne vom größten Teil der männlichen Belegschaft visuell abgetastet zu werden. Obwohl sie die gewandelte Einstellung der Welt den Frauen gegenüber zu dokumentieren hatten, blieben die Tageszeitungen doch Männerclubs. Es gab weibliche Hilfstruppen für Mode und Ernährung, und einige Frauen ließ man auch in die wichtigen Ressorts vordringen – irgendwer musste ja schließlich über die niedlichen kleinen Babys im Zoo schreiben –, doch die wenigen Frauen, die annähernd gleichberechtigt behandelt wurden, mussten willens und in der Lage sein, obszön daherzureden und andere unter den Tisch zu saufen.
»Niedlich«, meinte Bergman und versperrte mir die Sicht. Er war auf dem Weg, seine Theaterkritik abzugeben. »Soweit ich weiß, hat die halbe Tagschicht sie schon zum Lunch ausgeführt. Du wirst dich beeilen müssen.«
»Ich fang nie was mit Kolleginnen an.«
»Oh, Mr. Redlich.«
Nein. Ich hatte bloß noch nie einen Journalisten kennengelernt – Mann oder Frau –, der nicht entweder sehr dämlich, sehr idealistisch oder sehr naiv war. Mindestens eine dieser Eigenschaften ist absolut notwendig, um über sich ständig wiederholende Ereignisse so schreiben zu können, als würden sie zum allerersten Mal passieren, und dabei auch noch zu glauben, man könne irgendwas bewirken. »Wie war das Stück?«
»Eine Totgeburt.« Bergman reichte mir eine Kopie seiner Besprechung.
»Fünf Spalten für eine Totgeburt?«
»Manche Sachen sind so schlimm, dass sie einer ausführlichen Erörterung bedürfen.«
Ich warf einen Blick auf die Uhr. »Wenigstens war’s kurz.«
»Ich bin nicht bis zum Schluss geblieben.«
»Ist das nicht unethisch? Und was, wenn’s besser wurde?«
»Wird jemals irgendwas besser?«, philosophierte Bergman. »Wurde der Krieg besser, nachdem du nicht mehr dabei warst?«
»In gewisser Weise schon. Er ging irgendwann zu Ende.«
»Ich bin sicher, das Stück ging auch zu Ende.«
Ich hatte drei Jahre lang in Saigon gearbeitet, kam dann auf, wie ich glaubte, Heimaturlaub und fand mich in der Opferrolle wieder. Quinlan führte mich in sein Privatbüro, setzte sich auf seinen Schreibtischstuhl, als wollte er vorführen, dass der sich drehen ließ, und verkündete, dass sich die Leser nicht mehr für die andere Seite der Welt interessierten. Ihr Interesse gelte vielmehr der Stadt und ihren Menschen. Als ich meinte, der Krieg würde ohnehin bald vorbei sein, erwiderte er: »Genau.« Als dann das Ende kam, und ich rüber wollte, um über die Folgen zu berichten, sagte er nur: »Es ist vorbei.«
Ein Jahr lang arbeitete ich in meinem Privatbüro, schrieb über die Stadt und ihre Menschen, und die öde Langeweile wuchs und wuchs. In Saigon – New York einen halben Tag voraus – fühlte ich mich, als würde ich ganz vorn im Bug der Welt sitzen und als erster jeden Kurs- und Tempowechsel zu spüren bekommen. Zurück in New York hatte ich das Gefühl, ich hätte schon morgens beim Aufstehen alles verpasst. Ich bat Quinlan, mich zum Nachtdienst einzuteilen. Das verschaffte mir eine private Zeitzone, ich hatte die Tage frei, konnte auf Kosten der Firma lesen und gelegentlich in der letzten Ausgabe irgendein Ereignis unterbringen, das zumindest ein bisschen aus dem Rahmen fiel.
Ich gab Bergman seine Rezension zurück. »Du hast niemanden zitiert – nicht mal Shaw oder Aristoteles.«
Er errötete. Er reagierte sehr empfindlich auf meine Kritik, was seine seltenen literarischen Zitate anbelangte. »Ich spreche oft genug mit eigenen Worten.«
»Ist auch besser so«, sagte ich. »Wenn du bei einem Off-Broadway Stück T. S. Eliot erwähnst – so wie du’s letzte Nacht getan hast –, ist das genauso, als würde ich in einer Story über einen Großbrand in der Bronx den guten Dante zitieren.«
Er runzelte die Stirn, also buchstabierte ich es. »I-n-f-e-r-n-o.«
Er wechselte das Thema. »Susan hat in letzter Zeit öfters nach dir gefragt. Warum kommst du nicht Donnerstagabend zu uns zum Essen, und anschließend sehen wir uns zusammen ein Stück an? Da hast du doch frei, oder?«
»Ein ganzes Stück?«
»Das liegt allein bei dir. Ich weiß, wann ich genug gesehen hab.«
»Du hast Rokoko falsch geschrieben«, sagte ich. »Hinten -k-o-k-o.«
Jerry Oster ist 1947 in New Mexico geboren, kommt als Zehnjähriger nach New York, besucht die High-School, später die Columbia University, belegt als Hauptfach englische Literatur. Danach hat er einen Job bei United Press International News Service, dann bei Reuters und schließlich bei den New York Daily News. Ein Journalist, ein Mann wie manche seiner Protagonisten. Jerry Oster war Polizeireporter, hat unzählige Tatorte aufgesucht und über alle möglichen Verbrechen geschrieben.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783945684184
- Artikelnummer SW9783945684184
-
Autor
Jerome Oster
- Mit Werner Waldhoff, Doris Engelke, Denise Hillebrand, Christop Steinrücken, Stefan Linster
- Verlag spraybooks
- Seitenzahl 214
- Veröffentlichung 20.09.2017
- ISBN 9783945684184
- Mit Werner Waldhoff, Doris Engelke, Denise Hillebrand, Christop Steinrücken, Stefan Linster