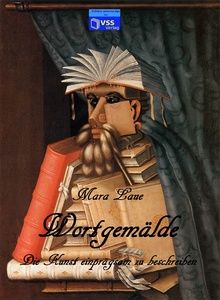Wortgemälde
Die Kunst einprägsam zu beschreiben
Gutes Beschreiben, die Kunst, mit Worten Bilder in die Köpfe der Lesenden zu „malen“, die ihnen das Geschehen im Buch anschaulich und vor allem erlebbar und nachfühlbar zeigen, ist eines der wichtigsten, aber auch am Schwierigsten zu meisternden Instrumente des Schreibhandwerks. In diesem Buch führt die erfolgreiche Autorin Mara Laue detailliert in diese Kunst ein und analysiert die Besonderheiten, die beim Beschreiben von Gefühlen, Landschaften, Menschen und Tieren zu beachten sind, welche Ausnahmen von der Regel existieren und welche Formen bei Science Fiction, Fantasy und einigen anderen Genres erforderlich sind. Textbeispiele verdeutlichen, wie durch „Beschreiben, nicht (nach)erzählen!“ das „Kopfkino“ in Gang gesetzt wird und spannende, lebendige Texte entstehen.
Warum „zeigen“ und nicht erzählen?
Vielleicht kennen Sie die Kunst des Beschreibens unter ihrem englischen Begriff „Show, don’t tell!“ – Zeigen, nicht erzählen! Wobei mit zeigen „beschreiben“ gemeint ist, die Technik, die Dinge im Text so anschaulich zu verdeutlichen, dass die Lesenden sie sich bildlich vorstellen können. Fast so intensiv und klar, als würden sie einen Film ansehen oder ein Foto betrachten und die Gegebenheit darin/darauf lebendig vor sich sehen. Aber warum ist das wichtig? Warum genügt es nicht, die Dinge einfach zu erzählen wie die Sprecherinnen und Sprecher der Tonspur für Sehbehinderte im Fernsehen das tun, wo nüchtern aus dem Off berichtet wird, was in der Szene zu sehen ist? Schließlich war diese Erzählweise – man nennt sie „allwissende Erzählperspektive“ oder moderner „auktoriale Perspektive“; „auktorial“ = durch den Autor/die Autorin – noch bis über den Anfang des 20. Jahrhunderts hinaus der Standard.
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst bewusst machen, was der Zweck belletristischer1 Literatur ist. „Belletristisch“ bedeutet „unterhaltend“ und die Belletristik ist die Unterhaltungsliteratur – Bücher, die man liest, um unterhalten zu werden, sich zu entspannen (trotz aller Spannung, die in guter Belletristik unabhängig vom Genre immer vorhanden sein sollte), in andere „Welten“ einzutauchen (auch wenn es sich nicht um Science Fiction handelt) und aus dem Alltag entführt zu werden.
Das bedingt, dass man sich in den Text, den man liest, hineinversetzen kann. Dass man darin „eintauchen“ kann und im Geist alles, was die Romanfiguren erleben und erleiden, lesend „hautnah“ miterlebt. Dass man mit ihnen lacht, mit ihnen weint, mit ihnen in brenzligen Situationen den Atem anhält, mit ihnen trauert, wütend ist, sich freut, friert, schwitzt, riecht und schmeckt und inständig hofft, dass am Ende alles für sie gut wird (und die „Bösen“ nachdrücklich bestraft werden). Als wenn man einen Film ansieht – mit dem einzigen Unterschied, dass dessen „Bilder“ ausschließlich in unserem Kopf ablaufen statt vor unseren Augen. Deshalb spricht man auch vom „Kopfkino“.
Um das zu erreichen, muss aber die Welt, in der die Romanfiguren leben und handeln, müssen ihre Gefühle, Gedanken und die jeweilige Situation, in der sie sich befinden, so beschrieben, den Lesenden so gut „gezeigt“ werden, dass diese sie vor ihrem geistigen Auge „sehen“ und im Fall von Gefühlen nachempfinden können. Sie müssen sie so intensiv wahrnehmen können, als würden sie selbst das Beschriebene „erleben“. Ohne ein Minimum an Beschreibungen – und je nach Genre auch mehr – kann man sich nicht in der Handlung orientieren.
Nehmen Sie einen Film als Vergleich. Darin sehen Sie die Umgebung, in der die Figuren sich befinden, und sehen, was sie darin tun. Ein Text ist kein Bild, das man sehen kann. Deshalb müssen wir Autorinnen/Autoren alle für die Handlung wichtigen Dinge den Lesenden zeigen, das heißt: beschreiben, um bei ihnen das „Kopfkino“ in Gang zu setzen, um mit Worten ein Bild in ihre Köpfe zu malen. Einfaches „(Nach-)Erzählen“ erreicht diesen Effekt nicht.
Betrachten wir zur Verdeutlichung ein altes Märchen als Beispiel: Hänsel und Gretel.
Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich abends vor Sorgen im Bette herumwälzte, sprach er zu seiner Frau: „Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, wenn wir für uns selbst nichts mehr haben?“ Da antwortete die Frau: „Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben ihnen noch ein Stück Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht mehr nach Hause, und wir sind sie los. (...) Sonst müssen wir alle viere Hungers sterben.“ (...) „Aber die Kinder dauern mich doch“, sagte der Mann.
Hier haben wir eine Nacherzählung reinsten Wassers. Sie zählt nüchtern und emotionslos Fakten auf: Der Holzhacker und seine Frau sind so bettelarme Leute, dass sie offensichtlich die meiste Zeit über hungern müssen, haben zwei Kinder, die sie eines Tages nicht mehr durchfüttern können, und entscheiden sich, die Kinder im Wald auszusetzen, weil sie alle vier nicht überleben können. Dem Vater tut die Entscheidung leid – und das war’s. Ohne Beschreibung machen wir als Lesende uns kein richtiges Bild davon, wie sich die Armut äußert. Wer noch nie über Tage oder sogar Wochen hinweg unfreiwillig hungern musste und nicht wusste, wann es die nächste Mahlzeit gibt, weiß nicht, wie sich das anfühlt und was ein solcher Zustand mit der Seele eines Menschen anstellt. Das erfahren wir Lesenden in dieser Nacherzählung auch nicht, weil darin nichts beschrieben wird. Die Not ist schließlich so groß, dass es ums nackte Überleben geht – und da müssen die Kinder „weg“.
Nüchtern betrachtet eine folgerichtige Entscheidung, denn die Kinder können allein nicht überleben, dazu sind sie zu klein. Und wenn die Eltern sich das Essen vom Mund absparen und es den Kindern geben, sterben die Eltern zuerst und die Kinder danach, weil niemand mehr für sie sorgt und sie deshalb ebenfalls verhungern müssen. Doch die Eltern lieben ihre Kinder. Trotzdem treffen beide diese entsetzliche, wenn auch einzig mögliche Entscheidung, die verhindert, dass sie alle vier sterben müssen. Aber kein Wort zeigt uns, wie sie sich dabei fühlen, wie entsetzlich der Entschluss für sie ist, wie schwer sie sich zu ihm durchgerungen haben, wie sehr sie darunter leiden, die geliebten, hilflosen Kinder auszusetzen und in den unvermeidlichen (Hunger-)Tod zu schicken oder als „Futter“ für Wölfe und Bären auf den Präsentierteller zu setzen. Sie tun es – und Schluss. Einziger Hauch von Emotion ist des Vaters Aussage: „Aber die Kinder dauern mich doch.“ In modernem Deutsch: „Aber die Kinder tun mir leid.“
Haben Sie beim Lesen des obigen Märchentextes irgendeine Emotion gefühlt? Haben Sie in den Text „eintauchen“, mit den Eltern fühlen, ihre Not und ihr Leid oder den Hunger, der in ihren Eingeweiden wütet, auch nur ansatzweise spüren können? Sicherlich nicht. Ein beschreibender Text, ein „Wortgemälde“ hingegen hätte Sie deren Qual so hautnah erleben lassen, dass Ihnen wahrscheinlich die Tränen gekommen wären.
Außerhalb von alten Märchen und Kurzgeschichten (die anderen Regeln unterliegen als Romane) genügt heute die Nacherzählung, das einfache Aufzählen von Ereignissen nicht mehr. Das Lesepublikum wünscht, dass wir Autorinnen und Autoren mit unseren Texten ihr Kopfkino einschalten. Darum sollten wir möglichst gut lernen zu „zeigen“, also zu beschreiben statt „platt“ im besten Aufsatz- und Märchenstil (nach-) zu erzählen.
DER UNTERSCHIED:
Der (Nach-)Erzählstil berichtet „von außen“ über jemanden oder etwas. Beim Beschreiben geht es um die Gefühle, Sinneseindrücke, Empfindungen, Assoziationen der Figuren selbst, das hautnahe Erleben einer Situation, einer Atmosphäre oder Stimmung durch die Figuren, mit ihren Augen und ausschließlich in ihrer Perspektive.
„Sylvia fand Lisas roten Mantel einfach scheußlich.“ Das ist eine Aussage über Sylvia. Sie vermittelt uns aber weder, warum sie den Mantel scheußlich findet, noch was genau sie an ihm stört. Das können wir den Lesenden nur mit einer Beschreibung des Mantels vermitteln, und zwar in Assoziation zu den Eindrücken und Gefühlen, die der Anblick des Mantels in Sylvia erzeugen (und damit auch in den Lesenden):
Ein rotes Nilpferd!, war Sylvias erster Eindruck, als Lisa lächelnd auf sie zu kam. Der zweite: ein außer Form geratenes Feuerwehrauto! Nein, der Vergleich hinkte, denn ein Feuerwehrauto besaß bei aller Wuchtigkeit noch eine gewisse Eleganz. Doch Lisas Mantel verlieh ihr das Aussehen einer Riesentomate und blähte ihre ohnehin sehr kurvige Figur optisch noch zusätzlich auf. Obendrein biss sich die Farbe heftig mit Lisas rotgefärbten Haaren. Sylvia hatte noch nie ein unvorteilhafteres Kleidungsstück gesehen, dessen bloßer Anblick nicht nur ihre Augen schmerzte. Was, um alles in der Welt, hatte Lisa veranlasst, dieses Ungetüm zu kaufen, geschweige denn, es auch noch anzuziehen und zur Schau zu stellen?“
Hier erfahren wir nachfühlbar Sylvias Entsetzen, um nicht zu sagen: ihren Schock, und haben einen sehr konkreten Eindruck von dem Mantel und auch seiner Farbe („feuerwehr-/tomatenrot“), den „scheußlicher roter Mantel“ uns nicht einmal ansatzweise vermittelt. Das ist der gravierende Unterschied zwischen „erzählen“ und „zeigen“ = „beschreiben“. Sie merken auch: Nur durch das Beschreiben, das „Zeigen“ wird ein Text „lebendig“.
Zum Beschreiben gehört zwingend, dass die Lesenden zu Beginn jeder Szene erfahren, WO die Handlung stattfindet, WER sich in der Szene aufhält, WORUM es darin geht und, sofern das zum Verständnis der Handlung wichtig ist, WIE es dort aussieht. Das Aussehen einer Person oder ihre körperliche Konstitution ist dagegen unwichtig, sofern das nicht eine bedeutende Funktion für die Handlung hat, zum Beispiel wenn Verletzungen oder Behinderungen beschrieben werden müssen, damit man sich eine Vorstellung von dem Ausmaß des vorher erfolgten Unfalls oder Angriffs machen kann. Die Haar- und Augenfarben oder die Größe sind dagegen in den seltensten Fällen erforderlich, sofern deren Beschreibung nicht genretypisch ist (zum Beispiel in Liebesromanen). Dazu später mehr.
Derartige „hinweisende“ Beschreibungen müssen je nach der Situation im Text nicht umfangreich sein: „Nora (= wer) rannte die Straße (= wo) entlang so schnell sie konnte (= wichtige Information), um noch pünktlich zur Arbeit zu kommen (= worum es „jetzt“ geht).“ Solche Hinweise genügen oft schon, um den Lesenden die Situation zu zeigen und für sie ein Bild entstehen zu lassen. „Straße“ = mindestens zweispurige gepflasterte Fahrbahn mit Bürgersteigen an jeder Seite (weil Nora nicht auf einer Autobahn oder mitten auf der Fahrbahn rennen könnte oder würde) und Häusern auf beiden Seiten. Außerdem deutet der Lauf „zur Arbeit“ an, dass sich die Szene in einer Innenstadt mit Geschäftshäusern abspielt, weil die meisten Menschen ihren Arbeitsplatz nicht in einer nur aus Einfamilienhäusern bestehenden Wohngegenden haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es früher Morgen, weil die meisten Berufstätigen ihre Arbeit morgens um acht Uhr beginnen (müssen). In jedem Fall haben die Lesenden durch diese Einleitung ein konkretes Bild vor Augen.
Wie genau die Straße aussieht (Pflasterung, Farbe, von Bäumen gesäumt oder nicht) oder was für Häuser sie beherbergt (Geschäftsgebäude, Hochhäuser, Wohnhäuser, Baustil) ist grundsätzlich unwichtig. Sollte ein Detail später gebraucht werden, wird nur dieses eine Detail an passender (!) Stelle erwähnt.
Grundsätzlich sollten Sie in jeder Szene, die Sie beginnen, die Lesenden möglichst früh über diese elementaren Dinge (wer, wo, worum es geht) informieren, sofern sich das nicht zweifelsfrei aus dem vorangehenden Text (Szene, Kapitel) ergibt. Das muss nicht gleich im ersten Satz geschehen, aber am Ende des ersten Absatzes sollte das klar sein, damit keine Fragen aufkommen oder die Lesenden sich falsche Vorstellungen machen, die sie später, wenn diese Informationen „nachgereicht“ werden, korrigieren müssen. Das gilt auch für die Nennung der jeweiligen Tageszeit, wenn sie zur Orientierung in einem Text wichtig ist.
Mara Laue (geb. 1958) lebt und arbeitet als Berufsschriftstellerin am Niederrhein. Sie schreibt Krimis, Thriller, Horror, Science-Fiction, Fantasy und Dark-Romance-Romane für diverse Verlage sowie Lyrik und Theaterstücke. Sie ist Autorin zweier eigener Okkultkrimi-Serien sowie zweier Science-Fiction-Serien. Wenn ihr das Schreiben die Zeit dazu lässt, arbeitet sie auch als Künstlerin und Fotokünstlerin. 2012 gewann sie für den Kriminalroman „Brocksteins letzter Vorhang“ ein „Tatort Töwerland“ Literaturstipendium der Insel Juist und erreichte eine Platzierung beim Sauerländer Theaterstückepreis für ihr sozialkritisches Stück „Abgestürzt“.
Mara Laue ist Mitglied der „Mörderischen Schwestern, Vereinigung deutschsprachiger Krimiautorinnen e. V.“, bei „DELIA, Vereinigung deutschsprachiger Liebesroman-Autorinnen und -Autoren“, bei „PAN – Phantastik-Autoren-Netzwerk e. V.“ und im „VS – Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller“.
Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)
Als Sofort-Download verfügbar
- Artikel-Nr.: SW9783961272952458270
- Artikelnummer SW9783961272952458270
-
Autor
Mara Laue
- Verlag Autoren.tips im vss-verlag
- Seitenzahl 271
- Veröffentlichung 11.08.2022
- ISBN 9783961272952
- Verlag Autoren.tips im vss-verlag